geograph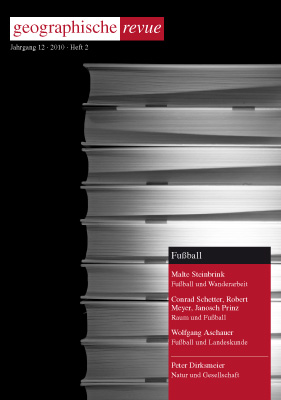 ische revue
ische revue
Fußball
„Ich bin ein Raumdeuter.“ – So könnte die Selbstbeschreibung eines heutigen Geographen, die wohl kürzeste Charakterisierung seiner Profession klingen. Er sieht, ja entdeckt Räume, die anderen unsichtbar bleiben, und macht sie zum Kern seines Interesses, zum Objekt seines wissenschaftlichen Handelns. Die konstruktivistische Wende der Geographie, insbesondere der aktuellen Kulturgeographie, hat die Vorstellung des absoluten, vorgegebenen Raums in die Konzeption eines Raums transformiert, der sich im Handeln und Denken der beobachteten Menschen konstituiert – Raum als wissenschaftsextern erzeugter Sachverhalt, den die Geographie zu beschreiben und analysieren sich aufmacht.
Dies geschieht nach dem Ende der mathematisch-geometrischen Raummodelle auf dem Wege der Deutung. Einen Raum zu deuten bedeutet zweierlei: ihn als Raum zu erkennen und ihn in seinem Raum-Sein zu verstehen, d. h. ihn aus seinem gesellschaftlichen Bedingtsein abzuleiten und auf seine Bedeutung für menschliches Handeln hin zu interpretieren. Die Regeln der Raumdeutung werden im Prozess der Deutung selbst entwickelt (gerne mit Verweis auf Verfahren der „grounded theory“) und ermöglichen die Einheit von gedeutetem Objekt und deutendem Subjekt. Insofern erzeugt Raumdeutung auch einen ganzheitlichen Bezug der Wissenschaft Geographie auf ihr zentrales Objekt: den Raum.
Die Schaffung von Raum durch die handelnden Menschen rückt ebendieses Handeln ins Zentrum der Betrachtung von Räumen. Wo auch immer Räume hergestellt werden, sei es durch physische Aktivität, sei es als Element von Kommunikation, existiert Geographie, wenn diese Räume vom Geographen beschrieben und untersucht, genauer: gedeutet werden.
Insofern ist Geographie das Auffinden von Räumen und deren Deutung. Dabei liegen die Grenzen der Geographie nur in ihr selbst, d. h. in ihrer Fähigkeit und Bereitschaft, Räume zu sehen und zu deuten. Geographie ist daher nicht auf (akademische) Geographen beschränkt, sondern leitet sich daraus ab, ob und inwieweit Raumdeutung stattfindet.
„Ich bin ein Raumdeuter.“ – Dies ist die in einem Zeitungsinterview geäußerte Selbstbeschreibung des Fußballspielers Thomas Müller (FC Bayern München; Süddeutsche Zeitung v. 8.1.2011), mit der er seine Fähigkeit umreißt, an Stellen des Spielfelds aufzutauchen, an denen ihn seine Gegenspieler nicht erwarten. Er nimmt Räume wahr, die durch das Handeln der anderen Spieler erzeugt werden, und er deutet sie. Im praktischen Handeln wie in der Selbstwahrnehmung zeigt sich im wesentlichen eines: Er ist Geograph. Und er hat der akademischen Geographie zwei Dinge voraus: Wie die Geographie erkennt er Räume und deutet sie, aber er weiß auch, dass er sie selbst schafft. Und er kann Fußball spielen.
Das vorliegende Themenheft der geographischen revue versucht, zumindest das letztere Defizit der Geographie zu verringern – zwar nicht durch ein Fußballspiel, das mit Druckerschwärze nur eingeschränkt zu führen ist, aber doch, indem aus geographischer Sicht, d. h. durch die Deutung von Räumen, Aspekte des Fußballs und durch die Deutung von Elementen des Fußballs gesellschaftliche Räume diskutiert werden. Der fußballgeographische Ansatz, wie er in diesem Themenheft exemplifiziert wird, zeigt seine Wirksamkeit in der Betrachtung von Migrationsvorgängen wie in der Landeskunde; nicht zuletzt kann er auch die Raumbildung und -deutung, von der das Zitat spricht, deutlich und plausibel machen.
Die Redaktion
Inhalt:
Malte Steinbrink
Fußball-Spiel und Wander-Arbeit
Conrad Schetter, Robert Meyer, Janosch Prinz
‚Totaal Voetbaal‘, ‚Ramba-Zamba‘ und ‚Tiqui-Taca’ – die Konstruktion von Räumen im Fußballspiel
Wolfgang Aschauer
Fußball und Landeskunde – das Beispiel des Budapester Fußballklubs FTC
Peter Dirksmeier
Stabilisierte Erwartungen: Über eine Funktion der Relation von Natur und Gesellschaft in der Geographie
Rezensionen
Wolf-Dieter Narr
Wie kommt’s zum Raum-Echo?
Olaf Kühne
Anmerkungen zu Wolf-Dieter Narrs Sammelrezension „Wie kommt’s zum Raum-Echo?“
Benedikt Korf
Frankreich
Veronika Daffner: Habitus der Scham – eine soziale Grammatik ungleicher Raumproduktion. Eine sozialgeographische Untersuchung der Alltagswelt Favela in Salvador da
Bahia (Brasilien). Passau 2010. (Ute Ammering)
Bestellungen bitte Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Das Heft kostet 15 Euro (incl. Versandkosten), gegen Vorkasse. Mitteilung der Kontoverbindung erfolgt nach Bestellung.