Helmut Klüter: Konstruktionen ohne 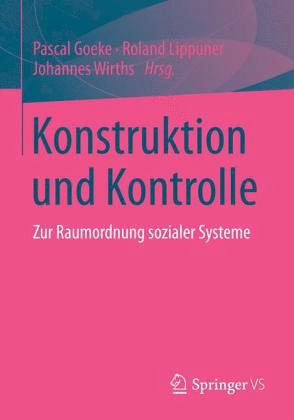 Kontrolle?
Kontrolle?
Rezension über:
Pascal Goeke, Roland Lippuner, Johannes Wirths (Hg.): Konstruktion und Kontrolle. Zur Raumordnung sozialer Systeme. Wiesbaden 2015.
Umfassende Sammelbände zur geographischen Theorie sind so selten geworden, dass hin und wieder die Nachbarwissenschaften in die Bresche springen (z.B. Döring, Thielmann 2008, 2009) – mit teilweise recht eigenartigen Ergebnissen. Daher ist es äußerst verdienstvoll, dass Pascal Goeke, Roland Lippuner und Johannes Wirths einige Ergebnisse des Netzwerks „Systemtheoretische Geographie“ gesammelt und publiziert haben.
Der Titel „Konstruktion und Kontrolle – Zur Raumordnung sozialer Systeme“ weckt die Erwartung, es ginge in diesem Buch um eine Umsetzung systemtheoretischer Leitlinien für Sozialgeographie. Doch schon die von Goeke, Lippuner und Wirths verfasste Danksagung (S. 5-6) verkündet eine andere Richtung: „Der Verlauf dieser Bewegung, die so nicht geplant war, wird nun im Rückblick deutlich. Er ist vielleicht am besten als Loslösung von der Idee einer Geographie sozialer Systeme und als Hinwendung zu einer allgemeinen Ökologie der Gesellschaft zu beschreiben.“(GLW, S. 5) Das wird zum Motto der von denselben Autoren verfassten Einleitung „Von der Geographie sozialer Systeme zu einer allgemeinen Ökologie der Gesellschaft.“ (GLW, S. 9-22)
Darin heißt es: „Mit den Leitbegriffen Konstruktion und Kontrolle ist deshalb eine doppelte Aufgabe verbunden: Prozesse und Produkte der sozialen Konstruktion von Raum – das heißt der Erzeugung und Verwendung von Raumsemantiken – sollen im Hinblick auf Möglichkeiten der Kontrolle des Raums – das heißt der Konfiguration der Umweltbeziehungen und der damit verbundenen Abhängigkeiten – analysiert werden.“ (GLW, S. 15) „Im Zuge des Nachdenkens über dieses Außen (Umwelt als „äußerer Raum“; H.K.) und die Umweltbeziehungen sozialer Systeme stößt das gängige Begriffsverständnis von Systemen möglicherweise an seine Grenzen. Diese Grenzen auszuloten und sie mithilfe alternativer Konzepte, auch aus anderen theoretischen Kontexten als der Systemtheorie, eventuell zu verschieben oder aufzuheben, ist ein Anliegen dieses Bandes.“ (GLW, S. 16, 17) Das Anliegen ist keineswegs so neu, wie es in diesen Sätzen anklingt. Bereits 2003 war unter dem Titel „Humanökologie. Ansätze zur Überwindung der Natur-Kultur-Dichotomie“ ein Sammelband mit ähnlicher Zielrichtung herausgegeben worden (Meusburger, Schwan 2003). Auch in diesem Band wurden ökologische, Akteur-Netzwerk-, systemtheoretische und andere Ansätze diskutiert. Dort wurde u.a. in Richtung auf eine Koexistenz argumentiert, was angesichts der andersartigen System- und Strukturbegriffe zwischen ökologischen und sozialsystemtheoretischen Konzepten auch weniger problematisch erscheint. Diese Art der Lösung wird bei Goeke, Lippuner, Wirths 2015 weder zitiert noch in Betracht gezogen, und somit bereits in der Einleitung ausgeschlossen. Damit wird der Ergebnisspielraum jenes „Nachdenkens“ (GLW, S. 16) erheblich eingeschränkt. Ein weiteres Problem stellt die unglückliche Begriffsbildung dar, unter der hier systemtheoretische Ansätze auftreten. Roland Lippuner hatte Mitte der 2000er Jahre eine „Geographie sozialer Systeme“ aus der Taufe gehoben. Der Begriff ist insofern widersinnig, als soziale Systeme keine räumliche Existenz haben. Demnach kann man ihnen auch keine Geographie zuordnen. Anders ausgedrückt: „Geographie sozialer Systeme“ ist etwa so sinnvoll wie „Geographie der Mathematik“, „Geographie der Kybernetik“ oder „Geographie der Wissenschaftstheorie“.
In dem folgenden Aufsatz von Johannes Wirths „Über Raum reden“ (S. 25-36) wird das zu beackernde Problemfeld erweitert: Ökologisierung, Mediatisierung, Globalisierung und Technisierung werden genannt, womit Geographie fast die gesamten Sozialwissenschaften schlucken würde. „Grenzziehung als Raumkulturtechnik“ (vgl. Wirths, S. 30), „die affirmativ-kritische Begleitung der gesellschaftlichen Zurichtung in Form von Ländern“ (vgl. Wirths, S. 30) sowie die „Zuwendung zur Entfaltung der diskursleitenden Unterscheidung sowie der Spiegelung dieses Prozesses in der disziplinaren Reflexionsformel, der Landschaft“ (vgl. Wirths, S. 30, 31) sollen die Arbeitsinstrumente liefern. Das klingt nach traditioneller deutscher Geographie aus der Zeit vor 1968, die sich seinerzeit ebenfalls erfolglos als Alleskönnerin angeboten hatte. Analog dazu wird Raum von einer Abstraktion zu einem Phänomen zurück gestuft: „Eine phänomenal angesetzte Räumlichkeit steht in den Cultural Turns und Studies also für eine intensive Weltbezogenheit, die sich mittels Raum als abstrakt-reflexiver Größe einer übermäßigen trivialisierenden Konkretion entzieht.“ (Wirths, S. 32) So etwas lässt sich auch in quasi-systemtheoretischer Rede kaschieren: „Jenseits des konkreten Beobachtens, also begrifflich, erscheint Raum dann als die Einheit der Differenz von Welt und Beobachter, Welt als die Einheit der Differenz von Ordnung und Ordnen, der Beobachter schließlich als die Einheit der Differenz von Unterscheidung und Unterscheiden.“ (Wirths, S. 34) Wie in einer schlechten Predigt bombardiert Wirths den Leser zu Beginn seines Raumgeredes mit 25 Suggestivfragen, die bereits die ersten vier Seiten einnehmen. Auf den restlichen sechs Seiten versteigt er sich bisweilen in wilhelminischen Bombast, der selbst dem geneigten Leser den letzten Glauben an wissenschaftliche Geographie rauben kann. Beispiel: „Räumliches Reden zieht also Reden über Raum und Räumlichkeit unvermeidlich nach sich.“ (Wirths, S. 28) Oder: „Als elementares Reden über die Welt, über ,die Ordnung der Dinge,‘ (Foucault 1974) „erzeugt eine so verstandene Räumlichkeit das reflexive Reden über Raum als eines über das Ordnen der Dinge.“ (Wirths, S. 29)
„Raum, formtheoretisch betrachtet“ lautet der Titel von Dirk Baeckers Beitrag (S. 3747). Raum wird dort noch einfacher als bei Wirths eingeführt: „Wir können nur zählen, weil wir sortieren, was um uns herum geschieht, davon ausgehend bestimmen, in welcher Entfernung es jeweils aufzufinden ist, und schließlich einschätzen, wie schnell es uns oder wir es erreichen können.“ (Baecker, S. 38) Es folgt ein Schlenker zu Spencer-Brown und seiner Formtheorie. Baecker gibt eine abschließende Empfehlung: „Die Geographie kann an sich selbst studieren, wie dieselbe Stabilität, die als Ausgangspunkt der eigenen Forschung unverzichtbar ist, sich im Zuge der Forschung in eine Instabilität (wenn nicht sogar Singularität, das heißt Unerforschbarkeit) verwandelt, die ihre robuste Resilienz einer Kippe, einer Asymmetrie von Weltall, Sonnensystem und Planet verdankt, die wir hier auf Erden, im sogenannten Anthropozän, mitzuverwalten begonnen haben.“ (Baecker, S. 46) Dieser Satz wäre reif für das Poesiealbum der Geographie, so sie denn eins hätte.
Ein politologischer Aufsatz befasst sich mit „Konstitutionalisierung von Hybridität. Governance in Europa“ und stammt von Poul F. Kjær (S. 120-144). „Die Frage, wie die konstitutionelle Form der EU am besten beschrieben werden kann, muss daher in zwei andere Fragen überführt werden: Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen der Regierungs und Governancedimension konkret, und wie können Beziehungen zwischen den verschiedenen Governancestrukturen in eine konstitutionelle Form gebracht werden?“ (Kjær, S. 123)
Er diskutiert die Staatsähnlichkeit der EU und kommt zu folgendem Schluss: „Kurz gesagt ist die EU eine hybride Struktur, die zwischen der Struktur eines Staates und jener von transnationaler Governance osziliert.“ (Kjær, S. 127) Da innerhalb der EU die Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition nicht funktioniere, müsse der Integrationsprozess als Erfolgsindikator gelten (vgl. Kjær, S, 128). Dabei wird Integration auf vordemokratische Weise durch Pay-offs von den einzelnen Mitgliedsstaatsadministrationen erkauft, z.B. durch die gemeinsame Agrarpolitik. Das institutionelle Gefüge der EU kreiert einen Rahmen, „in dem die Ausübung regulativer Funktionen davon abhängt, dass institutionelle Akteure, die befugt sind, Entscheidungen zu blockieren, mithilfe distributiver Politiker ,bestochen‘ werden.“ (Kjær, S. 132)
Eine gewisse Teilkonstitutionalisierung erfolgt durch den Europäischen Gerichtshof, allerdings ohne dass es eine allgemeine europäische Rechtsordnung gäbe. Echte Demokratie ist jedoch „untrennbar mit der Existenz von starken vertikalen politischen und rechtlichen Kontroll- und Forderungsstrukturen verknüpft, die auf der Unterscheidung zwischen Herrschern und Beherrschten basieren.“ (Kjær, S. 137) Abschließend stellt Kjær die These auf, dass der Korporatismus langsam verschwindet und Governance-Strukturen ihn als funktionales Äquivalent ersetzen. „Da Governance-Strukturen als hochdynamische autonome Strukturen verstanden werden müssen, ist eine ,staatszentrierte‘ Perspektive, die nur auf die Regierungsdimension abzielt, nach wie vor unzureichend.“ (Kjær, S. 140) Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Skandinavien, das ja nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern durch den Nordischen Rat auch sozialpolitisch viel stärker als die EU integriert ist, mag dieses Statement richtig sein. In den großen Staaten wie Deutschland oder Frankreich scheint der Einfluss der korporativen Gewalt ungebrochen. Letztere sucht vor allem in Deutschland durch direkte Zusammenarbeit mit der Administrativen Gewalt die Exekutive und die Legislative zu umgehen. Beispielsweise versuchen sie, diese mit einem irgendwie hergeholten Sparzwang derart zu knebeln, dass sich für die Wirtschaft größtmögliche Stabilität und für die Administrative Gewalt Autopoiesis in einem Ausmaß ergibt, von dem Luhmann nur träumen konnte.
Isabel Kusche schreibt über „Europäische vs. postkoloniale Staatsbildung im Kontext funktionaler Differenzierung. Das Problem der territorialen Kontrolle.“ (S. 97-119) Darin geht sie zunächst auf die staatlichen Strukturen in Westeuropa ein, differenziert dabei zwischen Politik und Wirtschaft, geht auf Monetarisierung der Wirtschaft und auf die Refinanzierung der Politik über Steuern ein. In Großbritannien stand im späten 19. Jahrhundert eine teilweise demokratisierte Struktur im Mutterland den teilweise feudalen oder nicht demokratisch kontrollierten Strukturen in den Kolonien gegenüber. Die Beziehungen zwischen Mutterland und Kolonien wurden durch den Handel bestimmt.
Der Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen und einer Verwaltung blieben in den ehemaligen Kolonien zurück. Die Zentrum-Peripherie-Differenz dominiere die politische Willensbildung, so Kusche, weil politische Macht sich über persönliche Beziehungen reproduziere.
„Eine handlungstheoretische Perspektive auf diese Folgen betont die räumliche Expansion der Bewegung von Gütern und Menschen und rechnet sie und die damit einhergehenden massiven Umbrüche dem Handeln bestimmter Akteure, nämlich einigen europäischen Staaten bzw. deren Eliten, zu. Die systemtheoretische Perspektive beschreibt dagegen, wie sich über einen längeren Zeitraum in der gesellschaftlichen Kommunikation mehrere hoch spezialisierte Leistungspunkte gegeneinander profilieren und so dauerhaft als differente Beobachtungsweisen etablieren [...]. Territorialstaatliche Grenzen versteht dieser Theorieansatz als Resultat eines spezifisch politischen Differenzierungsprozesses, der in anderen Funktionssystemen wie dem der Wirtschaft keine Entsprechung hat.“ (Kusche, S. 116)
Aldo Mascareño hat sich mit ähnlichen Themen befasst. Bei ihm stehen „Grenzen der Kontrolle: Institutionalisierung und Informalisierung des Raums. Das Beispiel Lateinamerika“ im Fokus (S. 145-176). Mit Marcelo Neves verweist er auf „symbolische Konstitutionalisierung“ und auf „negative Moderne.“ „Dabei handle es sich um Gesellschaften, in denen es ,weder eine adäquate Autonomie nach dem Prinzip der funktionalen Differenzierung noch die Verwirklichung der Bürgerrechte (citizenship) als Institution der sozialen Inklusion gegeben hat‘ (Neves 2006, S. 257). Dies habe zur Folge, dass es in Lateinamerika eigentlich keine funktionale Differenzierung gebe.“ (Mascareño, S. 147148) Anders ausgedrückt: Es kommt zu Entdifferenzierungsepisoden, in denen Gewaltanwendung, Zwang und Korruption Funktionssysteme in stratifizierte oder Clan- und Bandenstrukturen eingliedern. Faktisch existieren verschiedene gesellschaftliche Entwicklungsstadien über- und nebeneinander. Der modernen Gesellschaft werden Integration und eine relationale Raumauffassung zugeordnet. Dem Typ „Überlagerung“ mit selektiver Inklusion/Exklusion wird eine begrenzt relationale Raumauffassung zugestanden. Dem Typ „Abkopplung“ – etwa in Ghettos und Favelas – wird der Behälterraum als dominante Auffassung zugeschrieben. Trotz dieser enormen Differenzen versucht Mascareño unter Rückgriff auf Harrison White einen allgemeinen Kontrollbegriff zu installieren, der sich über Netzwerke aufbauen soll. Dabei wird nicht zwischen Selbst- und Fremdsteuerung unterschieden.
Insofern bleibt bei Mascareño auch das jeweilige Kontingenzportfolio unklar. Es kann z.B. sein, dass ein Priester sich in der funktional ausdifferenzierten Stadt über die religiöse Bannmeile nicht hinausbewegen darf und selbst innerhalb ein kirchenkonformes Leben führen muss. Dort, wo diese Kontrolle nicht ausgeübt wird – also möglicherweise in abgekoppelten Regionen – unterliegt der Priester nicht den organisatorischen Zwängen der Kirche und kann christlich-ethische Grundsätze ausleben.
Als Beispiel für Abkopplung analysiert Mascareño kriminelle Netzwerke in Buenos Aires und die Parallelmacht in Favelas. „Im jeweiligen Einzelfall kommen unterschiedliche Kontrollmechanismen zum Einsatz – Bestechung (Medium Geld), Zwang (Medium Einfluss) und Gewalt als symbiotischer Mechanismus. Dadurch schafft man soziale und sachliche Grenzen der Kontrolle, nämlich die sozialen Grenzen der Beteiligung an relationalen Netdoms (= Netzwerkdomains, H.K.) und Netzwerken, die über die Vorspiegelung von Rechtmäßigkeit gesichert werden, und die sachlichen Grenzen sozial abgekoppelter Gesellschaftsräume, die man mit Gewalt verteidigt. Funktionale Differenzierung in Lateinamerika basiert mithin auf einer Spannung zwischen einer Formalisierung und einer Informalisierung des Raums.“ (Mascareño, S. 172)
Dieser Schluss ist nicht zwingend. Die Alternative könnte die Einführung eines tragfähigen Regionsbegriffs sein. Das würde es erlauben, die angesprochenen Probleme nicht in konzeptionell unterschiedliche Strukturen wie Behälterraum und relationalen Raum zu packen, sondern aus sozialen Systemen abzuleiten, die die Möglichkeit haben, ihr System-Umwelt-Gefälle zu territorialisieren. Erst zum Schluss schimmert die Alternative durch: „Die zu beantwortende Frage lautet also, wie die universalen Prinzipien funktionaler Differenzierung mit den partikularen Prinzipien des Lokalen oder Regionalen kollidieren.“ (Mascareño, S. 174)
Katharina Mohring befasst sich mit dem „sichtbare(n) und unsichtbare(n) Raum der Massenmedien“ (S. 49-74). Zunächst postuliert Mohring, dass es unsichtbare, weil nicht kommunizierte Unterscheidungen, gäbe (vgl. Mohring, S. 51). Des Weiteren unternimmt sie die Unterscheidung zwischen Massen- und Verbreitungsmedien auf. „Ausgehend von der Überlegung, dass massenmediale Kommunikation zwischen überraschender Neuheit und akzeptiertem Informationswert, also Bekanntheit, oszilliert (vgl. Baecker 2005), wird an dieser Stelle das Medium der anerkannten nonfiktionalen Wirklichkeit vorgeschlagen.“ (Mohring, S. 57)
Von dieser ziemlich offensichtlichen Ontologie ist es nicht allzu weit zu einem ontologischen Raumbegriff: „Eine Sinndimension des Raumes – in ihrer allgemeinsten Form – bezeichnet das im Moment der Formbildung erzeugte Nebeneinander der einen Bezeichnung und der nicht bezeichneten anderen Möglichkeiten.“ (Mohring, S. 62) Damit landet sie eingestandenermaßen bei den eher rückwärtsgewandten Raumkonzepten von Kuhm und Wirths (Mohring, S. 63). „Raum ist nun genau genommen eine kommunikative Externalisierungsstrategie, die die kognitive Erfahrung und eine materielle Dimension außerhalb der Gesellschaft als Verweisungshorizonte benötigt, um die ja immer internen Kommunikationsprozesse durch räumlich gefasste Externa unterbrechen und stabilisieren zu können.“ (Mohring, S. 64) Hier wird ganz offensichtlich das organisatorische A-priori der Raumabstraktion unterschlagen. Die Erstellung von dauerhaften Raumabstraktionen verläuft nicht in irgendwelchen basalen Erkenntnis- oder Externalisierungsprozessen, sondern sozialwissenschaftlich relativ einfach zugänglich arbeitsteilig in spezialisierten Organisationen wie Behörden, Verlagen, Instituten und anderen Einrichtungen. Ein einzelner Mensch hat gar nicht die analytischen, finanziellen, drucktechnischen und vertriebsgebundenen Mittel, dauerhafte, gesellschaftlich wirksame Raumabstraktionen zu erzeugen. Auch Massenmedien können nur unter einem solchen organisatorischen A priori arbeiten. Insofern kann die anschließende quasi organisationslose „Raumdimensionale Beschreibung der Massenmedien“ (Mohring, S. 65-70) nicht überzeugen. Mohrings Satz in den Schlussbemerkungen „Jede massenmediale Bezeichnung berührt die unsichtbare Dimension des Raumes und erzeugt dadurch räumliche Sequenzierungen, die als Drittes mitlaufen und in den Informationen beobachtbar, also sichtbar werden“ (Mohring, S. 70) ist zumindest teilweise tautologisch und in der Sache verfälscht. Sollte damit räumliche Orientierung gemeint sein, wäre das auch ohne Rückgriff auf eine „unsichtbare Dimension“ zu theoretisieren. Wenn die Autorin wirklich an konstruierte Unsichtbarkeit glaubt, sollte das vielleicht in der Theologie, nicht aber in der Sozialwissenschaft diskutiert werden.
In seinem Beitrag „Grenzen, Grenzziehungen und das Ländliche“ (S. 75-93) versucht Marc Redepenning, die im Titel genannten altgeographischen Themen systemtheoretisch zu bearbeiten. Dabei geht er mit Robert Sack 1986 auch auf Territorialität ein. Er stellt fest, dass es soziale Systeme sind, die „nichträumliche Grenzziehungen verräumlichen, also Räume erzeugen“ (Redepenning, S. 82). Das führt zu einer „Betonung der Prozesshaftigkeit und der Operativität von Grenzen [...], der Relationalität der Grenze, [...] der Vergänglichkeit oder prinzipiellen Zerbrechlichkeit von Grenzziehungen.“ (Redepenning, S. 83-85) Dennoch mag er auf die altgeographische Ontologie der Grenze nicht ganz verzichten. „Diese zweite Form verweist also auf die materielle Dinglichkeit von Grenzen und Räumen (daher kann von der gestaltenden Demarkation von Grenzen gesprochen werden), die umso deutlicher und schärfer wird, je mehr materielle Investitionen sie in sich vereint.“ (Redepenning, S. 86). Allerdings sind es bei ihm keine formalen Organisationen, Behörden oder Unternehmen, die Grenzen ziehen, sondern raumbezogene Semantiken: „Daher bilden raumbezogene Semantiken oder Unterscheidungen auch keine Ordnung (weder eine soziale noch eine räumliche) ab, sondern erzeugen gerade diese Ordnung des Sozialen durch ihren Raumbezug. Man kann das gut an der raumbezogenen Semantik des ländlichen Idylls nachvollziehen.“ (Redepenning, S. 87)
Es folgen zwei Seiten Argumente, warum der Ländliche Raum vielleicht doch kein Idyll sein könnte, um ähnlich wie beim Fall der Grenze in den Schoß altgeographischer Ontologie zurückzufallen: „Eine Unterscheidung wie etwa jene zwischen Stadt und Land wäre dann gesetzte und fungierende Ontologie, um einen Ausdruck von Peter Fuchs zu verwenden: eine Gewissheit, die ausreichend vertraut ist, sodass sie durchaus ,psychische und soziale Verbindlichkei‘ ausbilden kann. (Fuchs 2004, S. 15).“ (Redepenning, S. 90) Das Ganze endet wie folgt: „Dann würden die diskutierten Raumsemantiken des Ländlichen das markieren und artikulieren, was in der Stadt und den durch sie hervorgebrachten gesellschaftlichen Raumverhältnissen absent ist, was ihnen fehlt.“ (Redepenning, S. 91) Viel platter kann man den Unterschied zwischen Stadt und Land kaum ausdrücken. „Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Semantik des ,einfachen und harmonischen‘ Ländlichen unter den heutigen beschleunigten und fluiden gesellschaftlichen Raumverhältnissen eine Renaissance erlebt und dabei klarer denn je eine Trennung zu Stadt markiert, um dann doch in letzter Konsequenz auf das Leben in der Stadt und auf die Ökologie der Stadt als andere, aber doch verbundene Seite hinzuweisen." (Redepenning, S. 91) So weit war Henri Thoreau mit Walden 1854 auch gekommen. Doch das Buch wird von Redepenning nicht erwähnt.
All das weckt eine gewisse Neugier nach dem, wie in dem hier besprochenen Buch das Städtische abgehandelt wird. Peter Dirksmeier und Roland Lippuner haben über „Mikrodiversität und Anwesenheit. Zur Raumordnung urbaner Interaktion“ geschrieben (S. 243-263). „Wie lässt sich das Urbane als ökologische Bedingung des Sozialen erfassen, wenn man vor dem Hintergrund einer systemtheoretischen Perspektive davon ausgehen muss, das Sozialsysteme keine räumlichen Gebilde sind, Raum also keine strukturierende Wirkung in Bezug auf das soziale System Gesellschaft zugeschrieben werden kann?“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 244) Sinnvoller und kreativer wäre sicher die umgekehrte Frage gewesen: Wie lässt sich das Soziale als Bedingung des Urbanen erfassen? Damit wäre man ziemlich schnell auf die Implikate der economy of scales gekommen, also auf großbetriebliche Organisation der Arbeitsteilung in Produktion, Infrastruktur, Versorgung und die entsprechenden Wohn- und Konsumaggregate. Doch diesen Weg beschreiten Dirksmeier und Lippuner nicht. Stattdessen wird der Begriff des Individuums rehabilitiert. Und die Individuen versammeln sich zur Stadt. „Eine solche Versammlung setzt aus systemtheoretischer Perspektive die Gleichzeitigkeit von Verschiedenen – räumliches Nebeneinander – und damit eine Synchronisation operativer Verläufe voraus. Diese Synchronisation – so die zentrale These des Beitrags – muss als Raumordnungsleistung begriffen werden, die durch Wahrnehmung von psychischen Systemen erbracht und von sozialen Systemen somit aus der Umwelt bezogen wird.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 245) Damit wäre man bei der Stadt als Ameisenhaufen, der konsequenterweise nur noch in Mikrodiversitäten zerlegt fassbar wird. „Der Begriff (Mikrodiversität, H.K.) bezeichnet die faktisch vorkommende Vielfalt von Ereignissen, die als Kommunikationsbeiträge interpretiert und weiterverwendet werden können.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 250)
Das wird nicht nur mit Luhmann, sondern in eigenartiger Verknüpfung mit Derrida, Foucault, Lefebvre, de Certeau und Fuchs zu belegen versucht. Nach diesem Cocktail wird zielstrebig ein ontologischer Raumbegriff verabreicht: „Die Versammlung von Akteuren und Objekten setzt Anwesenheit und damit die Gleichzeitigkeit von Verschiedenem sowie wechselseitige Wahrnehmung, das heißt eine Ordnung des Nebeneinanders und damit die Schaffung von Raum, voraus.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 254-255) Nun wird auch der bereits vermutete Ameisenhaufen präzisiert: „Die aus der Einschränkung der Möglichkeiten körperlicher Betätigung resultierende Unwahrscheinlichkeit von Anwesenheit geht im täglichen Erleben der Menschen verloren. Das dichte Gewühl der großstädtischen Straßen oder das Gedränge in der U-Bahn zur Stoßzeit lassen die Anwesenheit von anderen zu einer anregenden oder störenden, interessanten oder unangenehmen Tatsache werden.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 256) Oder einfacher ausgedrückt: „Eine Substanz ist in diesem Sinne präsent, wenn sie Raum für ihr Erscheinen braucht.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 258) Im Fazit heißt es: „Für Interaktion ist die Tatsache wesentlich, dass sie nicht bloß, wie Gesellschaft eine zeitliche Ordnung, sondern auch eine Raumordnung impliziert“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 260). Damit dürfte der Luhmannsche Interaktionsbegriff hoffnungslos überfordert sein, denn objektivierbare Zeitskalen können nur von Organisationen, also neben Interaktion dem zweiten Typ sozialer Systeme, erstellt werden, und für dauerhafte Raumbegriffe gilt ebenfalls – wie bereits erwähnt – ein organisatorisches A priori.
Das im Zitat explizierte Verständnis von Raumordnung ist mit dem institutions- und organisationsfundierten Begriff im Raumordnungsgesetz oder im Handwörterbuch der Raumordnung nicht vereinbar. Raumordnung wird in „Konstruktion und Kontrolle“ einerseits vom Normativen aufs Deskriptive reduziert und gleichzeitig dazu erweitert, fast alle Probleme der Welt zu umarmen: „Die sich damit einstellende Problematisierung alter sowie die Entfaltung neuer Raumordnungen kommt in den aufeinander bezogenen Prozessen der Ökologisierung, Globalisierung und Technisierung der Weltverhältnisse zum Ausdruck.“ (Goeke, Lippuner, Wirths, S. 9)
Zur Ausgangsfrage nach dem Städtischen wird im Fazit behauptet: „Weniger in der Bereitstellung von Inklusionschancen als vielmehr in der Mikrodiversität von Interaktionen – mit ihrer unerschöpflichen Vielfalt an Verhaltensweisen und Variationsmöglichkeiten – liegt somit die Bedeutung des Urbanen für die Gesellschaft.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 261) Man könnte es auch anders ausdrücken: Mikrodiversität kommt demjenigen organisationsfremden, auf Interaktion spezialisierten Milieu nahe, in dem üblicherweise Benno Werlens subjektzentrierte Handlungstheorie spielt. Dies kann als Verweis auf Lippuners geographietheorische Heimat gelesen werden, auch wenn Werlens Arbeiten in Dirksmeiers und Lippuners Literaturliste nicht mehr auftreten.
Die beiden Autoren schließen mit einem Sprung in die Vergangenheit: „Die Frage nach der Bedeutung von Präsenz in Interaktionen als Quelle der Mikrodiversität (und damit Anlass oder Antrieb der Selbstorganisation der Gesellschaft) schließt hingegen an jenes Forschungsprogramm an, das Robert E. Park unter der Bezeichnung ,Sozialökologie‘ auf den Weg gebracht hatte.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 261) Das war 1915, also vor 100 Jahren, und damit vor der Massenautomobilisierung, vor Mediatisierung und anderen Problembereichen, die die Herausgeber (GLW, S. 9-10) auf ihre Agenda gehoben hatten. Ob dieser Eskapismus in die Vergangenheit zielführend ist, dürfte mit Recht bezweifelt werden.
Roland Lippuner kommt mit einem weiteren Aufsatz zu Wort: „Information, Energie und Technik“ (S. 292-317). Wie im vorigen Beitrag wird auch hier so getan, als ginge es um Luhmanns Systemtheorie. Ausgangspunkt ist die etwas banale Feststellung, dass ein Ökosystem kein soziales System sein kann. Weiter heißt es: „Die Frage, die sich im Anschluss an diese Bemerkung stellt, ist deshalb auch weniger, ob der Ökosystembegriff eine adäquate Beschreibung ökologischer Probleme erlaubt; aus der Sicht der (sozialwissenschaftlichen) Umweltforschung stellt sich vielmehr die Frage, was der ,Problemkreis der Ökologie‘ nach Luhmann umfasst, und wie dessen Theorie zur Bearbeitung der darin enthaltenen Problemstellung beiträgt.“ (Lippuner, S. 294)
Genau das wird nicht geleistet. Stattdessen wird unter Rückgriff auf Kneer 2009 ein etwas abgehobener Produktionsbegriff eingeführt. Dabei geht es nicht um die Produktion von Waren und Dienstleistungen, sondern um die Produktion der Umwelt. „Produktion der Umwelt meint also deren physische (Um-)Gestaltung durch gesellschaftliche Prozesse (anthropogene Einflüsse), wie sie zum Beispiel unter dem Stichwort ,Anthropozän‘ (Crutzen, Stoermer 2000) oder mit Blick auf den globalen Klimawandel und die gezielte Veränderung biophysischer Substanz durch den Eingriff in genetische Programme diskutiert wird.“ (Lippuner, S. 298) Damit landet er bei der Akteur-Netzwerk-Theorie nach Latour (vgl. Lippuner, S. 299), um etwas unvermittelt auf T. Parsons kulturdeterministischen Ansatz sowie auf „Information und Energie“ – so die Überschrift des zweiten Abschnitts – einzugehen. Es folgen einige Gedanken, die wohl von Ernst Mach stammen, aber mit G. Bateson (1981 und 1982) belegt werden (Lippuner, S. 303-307). So gelangt er zum „soziobiotechnischen Komplex“ als großartigem Eintopf-Mix, den die traditionelle Geographie so liebt: „Bateson beschreibt mit Blick auf Prozesse der Informationsverarbeitung nicht die Eigendynamiken und das Zusammenspiel von operativ geschlossenen, selbst referenziellen Kommunikations- und Bewusstseinssystemen, sondern ein ,Ökosystem‘, das auch Gegenstände, Organismen und Techniken umfasst und damit aus der systemtheoretischen Sicht von Luhmann im Grunde kein System ist, sondern ein ökologischer oder – wenn man so will – ein soziobiotechnischer Komplex.“ (Lippuner, S. 305)
Damit wird zum Thema „Technik“ gesprungen (Lippuner, S. 309-313). „Technik, so fasst deshalb Baecker (2011, S. 179) zusammen, ist die Einrichtung einer Sequenz von Ereignissen derart, dass diese Sequenz wiederholbar abgerufen werden kann.“ (Lippuner, S. 310-311) Diese Definition ist schon deswegen unscharf, weil sie auch auf die Programmierung in Organisationen zutrifft, also auf bestimmte soziale Systeme. In diesem und in den folgenden Zusammenhängen verwundert es, dass Lippuner präzisere systemtheoretische Annäherungen an Technik, z.B. Ropohl (2009), überhaupt nicht erwähnt.
Im Abschnitt „Fazit“ wird der bereits erwähnte „soziobiotechnische Komplex“-Eintopf noch einmal aufgewärmt. Außerdem entdeckt Lippuner für sich, aber auf der normalen Zeitachse mit gut fünfzigjähriger Verspätung, dass soziale Systeme strategisch handeln können, was natürlich nicht mehr mit zweitwertiger Kausalität abzubilden ist: „ Im Hinblick auf die Kopplung heterogener Elemente durch Technik macht die Betrachtung unter informatorischem Gesichtspunkt deutlich, dass Kontrollmöglichkeiten auf jene Verhältnisse beschränkt sind, bei denen man jederzeit mit einer Vielzahl von (eventuell unabsehbaren) Reaktionen rechnen muss. Verbindungen nach dem klassischen Schema der instruktiven, eindeutigen und unumkehrbaren Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen (Durchgriffskausalität) kennzeichnen hingegen den konditionalen Aspekt von Kopplung; hier, so könnte man sagen, passiert, was passiert, ohne Rücksicht auf die ,Einsprengselung‘ von Systemen, mit denen die ökologischen Komplexe ausgestattet sind (Fuchs 2010, S. 237).“ (Lippuner, S. 314)
Den Netzwerk-Theorien wurde von Pascal Goeke und Swen Zehetmair ein eigener Beitrag gewidmet: „Räumliche Konditionen und die Kontrolle des Raums durch Netzwerke und soziale Systeme“ (S. 177 -201). Ihre Aufgabe umreißen die Autoren wie folgt: „Wärrend bei der allgemeinen Netzwerktheorie der Grundbegriff der Theorie mit dem zu erklärenden Problem zusammenfällt und damit überlastet wird, zieht die Systemtheorie Explanans und Explanandum ungleich stärker auseinander. Netzwerke gelten ihr als ein bemerkenswertes und von anderen sozialen Formen unterscheidbares Phänomen (vgl. Bommes, Tacke, 2006, S. 39). Die unterschiedlichen Aussagen darzustellen und aufeinander zu beziehen sowie anschließend nach den Lernmöglichkeiten zu fragen, ist das Ziel dieses Beitrags.“ (Goeke, Zehetmair, S. 180)
Es geht also um einen Vergleich von Netzwerk- und Systemtheorie, d.h. auch um Gemeinsamkeiten. Als solche sehen Goeke und Zehetmair die Ontologie der Setzungen „Es gibt Systeme“ und „Es gibt Netzwerke“ (vgl. Goeke, Zehetmair, S. 177, 178). Dieser Einstieg zu Beginn des Beitrags ist unglücklich. Man hätte auch auf die gemeinsamen Wurzeln in Kybernetik und Mathematik verweisen können. Jene wenig überzeugende Argumentation wird wenig später auf Raum übertragen: „Entsprechend – und gewissermaßen als ein empirisches Beispiel für das eben Gesagte – überrascht die in diesen Netzwerkstudien mitgeführte Sicht auf Raum nicht: Raum wird ontologisiert. So stehen die identifizierten Personen in Netzwerkstudien für Bewusstseine, deren Relation (Kommunikationen) quasi unweigerlich in einem Raum stattfinden müssen.“ (vgl. Goeke, Zehetmair, S. 183-184) Auf S. 186 staunen die Autoren über die offenbar für sie neuen Effekte räumlicher Orientierung, obwohl dieser Begriff bereits ein Vierteljahrhundert zuvor als Grundbegriff für Sozialgeographie eingeführt wurde. Beispiele aus dem Luftverkehr und aus dem Geldumlauf sollen die Relevanz räumlicher Zentralität bzw. die der Auswirkungen der Raumabstraktionen des politischen Systems auf nicht politische Kommunikationen belegen (vgl. Goeke, Zehetmair, S. 187-189). Das führt zu Toblers Satz aus dem Jahre 1970: „Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things“ (vgl. Goeke, Zehetmair, S.189). Er steht im diametralen Gegensatz zur Feststellung von G. Bahrenberg, die Dirksmeier und Lippuner einige Seiten später für ihre Argumentation benutzen: „Räumliche Nähe kann alles bewirken, einschließlich des jeweiligen Gegenteils, und damit nichts. Sie scheint mir jedenfalls für einen Einsatz in theoretischen Überlegungen völlig unbrauchbar.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 244) Hier wäre es sinnvoll gewesen, wenn die Autoren sich besser abgesprochen oder ihre jeweilige Position klarer erläutert hätten.
Das dritte Kapitel des Beitrags lautet „Konstruktion und Kontrolle des Raums“. Es war offenbar so wichtig, dass die Überschrift in den Titel des Buches übernommen wurde. Daher sei gestattet, hier mehrere Aussagen zu präzisieren und zu korrigieren. „Die regelmäßig erhobene Klage, dass die Soziologie nicht genug über den Raum wisse, muss daher immer auch begründen, warum dies ein wirkliches Manko darstellt. Die Ironie der dann anlaufenden Raumdiskussion ist allerdings, dass sich das soziologische Nachdenken über den Raum kaum von einfachen Vorstellungen des Alltagserlebens distanziert (vgl. Kuhm 2003, S. 13).“ (vgl. Goeke, Zehetmair, S. 190) Die dort zitierte Meinung entstammt keineswegs Kuhms Selbstkritik, wie es in dem Zitat den Anschein hat. Er ist vielmehr eine schwache Erinnerung an das, was den Beiträgen von Kuhm, Stichweh, Sturm und Matthiesen auf den Delmenhorster Tagung „Die soziale Konstruktion des Raumes“ am 15.03.2002 von Bahrenberg und Klüter vorgeworfen wurde: naive, prägeographische Argumentation. Besonders viel Diskussion rief der inkonsistente Beitrag von Stichweh hervor. Zwar wurde er für den späteren Tagungsband als „Raum und moderne Gesellschaft. Aspekte der sozialen Kontrolle des Raums“ überarbeitet, jedoch ohne dass grundsätzliche Mängel abgestellt wurden. Es ist der Artikel, auf den sich Goeke und Zehetmair auf den Seiten 190ff. mehrfach berufen. Der Delmenhorster Dissens führte dazu, dass im Tagungsband Klüters Name aus den Literaturverzeichnissen gestrichen (Ausnahme: der Aufsatz von Bahrenberg), seine Teilnahme an der Tagung und sein Beitrag verschwiegen wurde (vgl. Krämer-Badoni, Kuhm 2003). Der Beitrag erschien stattdessen in der Geographischen Zeitschrift unter dem Titel „Raum und Kompatibilität“ (Klüter 2002).
Stichweh hat bis heute große Skrupel, Klüter zu zitieren, lässt sich aber dennoch gern von ihm inspirieren. Eine dieser Arbeiten ist „Kontrolle und Organisation des Raums durch Funktionssysteme der Weltgesellschaft“ (2008), in dem die Raumabstraktionstypen aus Klüter (1986, S. 110 ff., 1999, 2006) Ergänzungsraum (Wirtschaft), Administrativraum (Politik), Heimat (Intimbeziehungen), Landschaft (Kunst) als so genannte „Eigenräume der Funktionssysteme“ verkauft werden (vgl. Stichweh 2008, S. 159-162). Bereits vorher waren die bei Klüter vornehmlich von Organisationen (als besonderem Typ sozialer Systeme) ausgehenden Strategien der Fremdsteuerung mit ihrem Gegenteil, der Selbststeuerung, zu weitgehend harmloser, weil nicht adressierter „Kontrolle“ verschmolzen worden. Abstraktion wurde in Konstruktion verbogen, obwohl es sich bei Raum aus mathematischer und geographischer Sicht eindeutig um eine Abstraktion handelt. Der in Klüters Kontext sinnvolle Begriff einer raumbezogenen Semiotik wurde in inflationär genutzte „Raumsemantik“ verfälscht – was von Goeke, Lippuner und Wirths auf S. 12 unkommentiert wiederholt wird. Um die Verwirrung zu vervollständigen, wird „Raumsemantik“ dabei häufig als Synonym für „Raumabstraktion“ genutzt, als ob die Exaktheit einer Maßstabsangabe oder eines abgebildeten Straßenverlaufs durch eine Philosophie von 1000 Worten eingeholt werden könnte. Peinlich ist für Goeke und Zehetmair – wie für Lippuner (S. 302) und später auch für Egner und von Elverfeldt (S. 333 ff.) –, dass sie sich nicht am geographischen Original, sondern an den soziologischen und literaturwissenschaftlichen Nach- und Umdichtungen orientieren. Bedenkenlos und ohne Kritik schwafeln auch Goeke und Zehetmair unter Rückgriff auf Stichweh 2008 von „Eigenräumen“ (Goeke, Zehetmair, S. 193, 196). Ihr Fazit lautet: „Um die Systemtheorie dem (Erd-)Raum-Argument zu öffnen, orientierte sich dieser Beitrag an Stichwehs Vorschlag, die Formel der sozialen Konstruktion von Raum durch die soziale Kontrolle des Raums zu ersetzen.“ (Goeke, Zehetmair, S. 197). Geht man auf die ursprünglichen Begriffe zurück, hieße dies, man könne Abstraktion (im Zitat: Konstruktion) durch Fremdsteuerung (im Zitat: Kontrolle) ersetzen – was kompletter Unsinn ist. Hier ergibt sich die Frage, warum die Autoren besonders schwache systemtheoretische Arbeiten als Grundlagen für ihren Beitrag ausgewählt haben. Als eleganterer Einstieg in das räumliche Kontrollproblem hätte sich die Adresse als Immobilitätsmodell eigentlich mobiler Personen, Organisationen und Gegenstände angeboten. Diese werden über ihren Namen oder eine Chiffre archetypisch von Administrationen an ein Grundstück gebunden, um Erreichbarkeit und für einige Organisationen auch Kontrollierbarkeit – im Sinne von Überwachung und Fremdsteuerung der Handlungs- und Kommunikationsbeteiligten – zu gewährleisten.
Dies führt auf einen Aspekt von Netzwerktheorien, der bei Goeke und Zehetmair überhaupt nicht zur Sprache kommt: die Differenz zwischen erzwungenen, oft automatisierten Netzwerken innerhalb eines Unternehmens, einer Behörde oder Organisation einerseits und zwischen „freien“ bzw. freiwilligen Netzwerken, die einzelne Organisationen, Personen oder Gruppen ohne äußerlich verfassten oder vertraglichen Organisationsdruck aufbauen. Der erste Fall ist in der Regel mit institutionalisierter Fremdsteuerung verbunden, der zweite nicht. Der erste Fall wird häufig über eine oder mehrere Grundstücksbindungen stabilisiert und ist damit territorialisiert, der zweite könnte auch ohne letztere auskommen.
Des Weiteren muss aus geographischer Sicht die Setzung „Es gibt Netzwerke“ kritisiert werden. Bevor Netzwerke entstehen, muss es Adressen geben. Die Frage, wie aus welchen Sprachräumen welche Adressen unter welchen Selektionsgesichtspunkten ausgewählt werden, kann geographisch interessant und für die Kapazitäten und Aufgaben eines Netzwerks von großer Bedeutung sein.
Mit Peter Fuchs tritt nach Dirk Baecker ein weiterer direkter Luhmann-Schüler auf den Plan. Der Titel seiner Arbeit lautet: „Die Materialität der Sinnsysteme“ (S. 205-221). Mit seinen Rückgriffen auf Phänomenologie und Existenzialismus demontiert er das Systemische an Luhmanns Systemtheorie. Die ursprüngliche Differenzierung in soziale, psychische, personale, biotische, abiotische, technische und andere Systeme wird auf fast jeder Seite des Beitrags mindestens einmal durchbrochen. Als Verbindendes tritt nicht mehr der Systemaspekt auf, sondern die Unterstellung einer Bindung an Materie. So befassen sich die einzelnen Abschnitte mit der „Materialität psychischer Systeme“, der „Materialität der Kommunikation“, der „Materialität von Sinn“ und schließlich der „Materialität des Todes“. Dabei liest sich die Materialität des Todes ähnlich wie bei einigen Sekten der Gottesbeweis: als Negation der Negation der Negation der Negation. Fuchs kommt zu dem Schluss: „Vielleicht kann man Luhmanns Satz ,Im Begreifen des Todes tritt das Medium Sinn in Widerspruch zu sich selbst‘ zustimmen, aber dann die Kautel hinzufügen: Die Erscheinung des Widerspruchs setzt den eben diskutierten Reentry voraus, theoretisch lesbar als Einspiegelung des unmarkable space des Todes für Sinnsystem in die markierbare (erfahrbare) Differenz der Lebenden und der Toten“ (Fuchs, S. 214, 215). Eine mögliche kommunikativ multiplizierte Sinnhaftigkeit eines Todes – wie etwa im Christentum der Tod Jesu oder in der Kriegsideologie die Rechtfertigung des Todes als sinnvolles Opfer für das Vaterland – wird ausgeblendet. Das Ziel des Ganzen ist ziemlich durchsichtig: die Ontologisierung des Körpers: „Sie bestätigt die Unverhandelbarkeit des Körpers als eines Letztprinzips, wie es einst die Materie war oder die metaphysischen Instanzen. Er ist gegen alle Unkenrufe die fortwährende Bekräftigung einer fungierenden Ontologie: Es gibt ihn, den Körper.“ (Fuchs, S. 217)
Selbst Fuchs ist klar, dass ein solcher Schluss mit keiner Systemtheorie vereinbar ist, weder mit sozialer, physischer oder biotischer. Er behilft sich damit, auf den „Beobachter dritter Ordnung“ zurück zu kommen (vgl. Fuchs, S. 218), der hier für seinen leicht vereinfachten Existenzialismus zuständig sein soll.
Mit diesem Aufsatz fallen die letzten Skrupel, irgendwie diszipliniert sozialwissenschaftlich, sozialgeographisch oder systematisch zu argumentieren. Michael Guggenheim, Anna Henkel, Kirsten von Elverfeldt und Heike Egner reizen in ihren Beiträgen den damit gewonnenen Spielraum weiter noch als Wirths aus. Bei Guggenheim und Henkel mutiert die bei Fuchs noch vorsichtig eingebrachte Materialität zu drastischer „Dinglichkeit“. Guggenheims Thema lautet: „Katastrophen als Formwechsel. Horizontverschiebungen und die Endostruktur der Gesellschaft“ (S. 267- 291). Ähnlich wie Goeke und Zehetmair landet er nicht bei, sondern startet mit plattester Ontologie: „Die stets zunehmende Anfüllung mit Dingen ist offensichtlich.“ (Guggenheim, S. 274) Die bereits erwähnte Empirie des Ameisenhaufens (vgl. Dirksmeier, Lippuner, S. 254-256) wird hier durch die des Müllhaufens erweitert. Und: Das war es eigentlich schon: „Unter Endostruktur fasse ich die Gesamtheit der dinglichen Stützung der Gesellschaft.“ (Guggenheim, S. 274) Da scheint bereits im Hintergrund der uralte allumfassende Erdraumbegriff zu lauern. Doch zunächst trifft es nur den Stabmixer als Beispiel für immutable mobiles: „Ein typisches Beispiel dafür ist der Stabmixer: Wenn man ihn einschaltet, zerkleinert er zuverlässig Lebensmittel.“ (Guggenheim, S. 275) Ontologie bleibt aber im Blickfeld: „Die moderne Gesellschaft zeichnet sich durch ein spezifisches Ineinandergreifen all dieser Elemente aus. Jedes dieser Elemente unterliegt einer historischen Ontologie und Epistemologie.“ (Guggenheim, S. 276) Nun wird es raumnäher: „Wir können die dingliche Stützung der Funktionssysteme den Horizont der Moderne nennen. Horizont insofern, als es sich um etwas handelt, das in der Ferne als Begrenzung der Welt erscheint.“ (Guggenheim, S. 278) Im Falle einer Katastrophe schrumpft der Horizont auf die Idee des Bunkers: „Spezifisch für die Idee von Bunkern ist, dass sie Gesellschaft räumlich auf eine minimale Fläche zusammenschrumpfen, die zudem kommunikativ abgeschlossen ist.“ (Guggenheim, S. 283) Auch Mobilitätsanalyse wird auf ein neues Banalitätsniveau gehoben: „Neben den sich in die Katastrophenregion hineinbegebenden Politikern und Journalisten gibt es oft auch Personen, die sich aus ihr herausbewegen, sowohl kurzfristig, indem sie fliehen, als auch langfristig, da ihre Gebäude und Arbeitsplätze zerstört sind, was wiederum zu Infrastrukturproblemen führt.“ (Guggenheim, S. 286) Etwas zynischer fällt das Kapitel „Schluss“ aus: „In diesem Beitrag habe ich versucht, eine positive Theorie der Katastrophe zu entwerfen. [...] Dazu wurden Theoreme der Akteur-Netzwerk-Theorie, insbesondere die Grundannahme, dass die moderne Gesellschaft zunehmend dinggestützt ist, mit der Theorie funktionaler Differenzierung kombiniert.“ (Guggenheim, S. 288). Katastrophen evozieren Lerneffekte: „Unabhängig vom spezifischen Fall der Katastrophe geht es mir hier auch um den Versuch, die unfruchtbare Opposition zwischen kommunikationstheoretischen Ideen funktionaler Differenzierung und dingbasierten Theorien zu durchbrechen. Der Katastrophenfall mag besonders geeignet sein, solche Verschiebungen zu analysieren, aber er ermöglicht es auch, ex negativo den Normalbetrieb der Moderne zu analysieren.“ (Guggenheim, S. 288) Mit einer ähnlichen „ex negativo“-Gedankenfigur hatte schon Fuchs seine „Materialität des Todes“ gerechtfertigt (S. 215). Sie könnte an Guggenheims Ausführungen direkt angeschlossen werden. Sollte es während der nächsten Katastrophe im Bunker langweilig werden, könnte Guggenheim die beiden Texte dort verlesen.
Bei Anna Henkel schafft „Dinglichkeit“ es sogar in den Titel: „Gesellschaftliche Konstitution und Kontrolle von Dinglichkeit“ (S. 223-242). „Um jedoch Dinglichkeit in den Blick nehmen zu können, ist eine Erweiterung der Systemtheorie notwendig. Diese erfolgt hier ausgehend von der frühen, auf dem Sinnbegriff basierenden Fassung der Systemtheorie mit Konzepten der Plessnerschen Positionalitätstheorie.“ (Henkel, S. 223) Neben Guggenheimschen Katastrophen geraten nun auch Krisen in den Fokus, und zwar Tschernobyl, Fukushima, Contergan, biotechnische Risiken, Fracking-Risiken, Burn out, Immobilienkrise und Jugendarbeitslosigkeit, um Kontrollverluste vor dem Hintergrund einer angeblichen Missachtung der Dinge zu diagnostizieren (vgl. Henkel, S. 224, 225). „Dinge sind aus dieser Perspektive nicht einfach qua Nichtsozialität ausgeschlossen, sondern repräsentieren ebenso wie andere Zeichen eine bestimmte Kultur; dazu gehört, dass der richtige Gebrauch der Zeichen, also auch der richtige Umgang mit Dingen, den sozialen Standort der sie gebrauchenden Akteure bestimmt.“ (Henkel, S. 228, 229) Auch hier wird der frühere Latour mit seiner von ihm selbst teilweise zurück genommenen Akteur-Netzwerk-Theorie (vgl. Latour 2012) bemüht, „Dinge nicht nur als Voraussetzung oder als Repräsentanten des Sozialen zu betrachten, sondern als ,Mit-Akteure‘, wie es etwa in der Akteur-Netzwerk-Theorie vorgeschlagen wird.“ (Henkel, S. 229) Und so schließt sie denn auch falsch: „Ein Wandel der Grenzen des Sozialen und damit verbunden ein Wandel der Art und Weise, wie das Soziale und das Nichtsoziale semantisch konzipiert sowie erwartungsstrukturell aufeinander bezogen sind, ist systematisch unbeobachtbar.“ (Henkel, S. 230) Wenn dem so wäre, könnte ein arbeitsteiliges Unternehmen seinen Personaleinsatz nie an technischen Innovationen ausrichten. Der Betrieb ist als Organisation ein soziales System, sein Fließband samt Gebäude ein technisches System – über dessen Nutzen das soziale System Entscheidungen fällt.
Schließlich kommt Henkel, wie vorher Fuchs, auf Körperliches – also auf biotische Systeme. Zur Erlebnisverarbeitung sei ein Körper nötig, und zur Negation erst recht (vgl. Henkel, S. 231, 232). „Diese Fundierung der Systemtheorie im Sinnbegriff und der Rekurs auf die ,eigentümlich menschliche‘ Eigenschaft des Negierens erlaubt es jedoch, den systemtheoretischen Kurzschluss von bewusstem Erleben auf sozial-kommunikativ vorstrukturiertes Erleben – und damit von Sinn auf sozialen Sinn – zu beheben. Das sozialtheoretische Scharnier dieser Rückerweiterung liefert das in der Systemtheorie durchgehend zentrale Konzept der Negation. Das theoretische Rüstzeug dafür bietet Plessners Konzept des exzentrisch positionalen Selbst.“ (Henkel, S. 232) Die von Goeke, Lippuner und Wirths anfangs in Aussicht gestellte Erweiterung der Systemtheorie erfährt hier eine Nuancierung: „Rückerweiterung“ als das Zurückgehen auf die philosophischen, anthropologischen und soziologischen Vorstufen der Systemtheorie hilft nicht nur Henkel zu verstehen, sondern scheint eine Schlüsselstrategie für die Gesamtanlage der geographietheoretischen Arbeiten in dem Sammelband zu sein. Fast jeder der Autoren findet eigene Wege und Mittel, um sich in Vergangenes zu flüchten. Bei Henkel geht das so weit, dass sie nicht einmal merkt, wie nahe die an Plessner 1928 orientierte Definition des „Dings“ der späteren systemtheoretischen Definition eines Systems kommt: „Bereits das Ding unterscheidet sich von einer undifferenzierten Umwelt, indem es an einer bestimmbaren Grenze endet“ (Henkel, S. 232) – also fast das klassische System-Umwelt-Gefälle. Es ergibt sich die Frage, wozu man heute noch das „Ding“ benötigt.
Allerdings läuft bei Henkel das „Ding“ schnell wieder aus dem Ruder: „Dinglichkeit wird im Anschluss an diese Überlegungen im Folgenden verstanden als Verbindung von Substanzkern und Eigenschaften, wobei gleichermaßen räumliche wie auch unräumliche (körperliche und unkörperliche) Dinglichkeiten einbegriffen sind. Auch das exzentrisch positionale Selbst ist in diesem Sinne eine Dinglichkeit, allerdings spezifiziert als lebendiges, zentrisch organisiertes und mit exzentrischer Reflexivität ausgestattetes Ding.“ (Henkel, S. 234) Langsam wird das Ziel dieser Alchimie klarer: „Mit einer neuen Betonung leiblich-körperlichen Sinns lässt sich die Raumdimension wieder einführen“ (Henkel, S. 235), diesmal also subjektivistisch gefärbt. Damit kann die Geographie erneut so viel leisten wie bei Wirths, nämlich alles: „Das so umrissene Analysespektrum ist geeignet, Studien hinsichtlich aller Fragestellungen einzuleiten, die Dinglichkeit betreffen, von der Stadt und dem Wohnraum über wissenschaftliche und technische Dinge bis hin zu Alltagsgegenständen.“ (Henkel, S. 238) Am Beispiel der Bodenpolitik soll die Leistungsfähigkeit der alten Ideen bewiesen werden: „Die Entwicklung des Pfandbriefs sowie des Immobilien- und Erbbaurechts zeugen von den differenzierten Zugriffsmöglichkeiten auf den Grund und Boden sowie davon, was man damit machen kann. Land wird auf diese Weise – ähnlich dem originalverpackten Fertigarzneimittel – zu einem fungiblen Ding, das weder an Interaktionen und Personen noch an Ort und Zeit gebunden ist [...]. Obwohl der Grund und Boden zunächst gerade nicht zu den Dinglichkeiten gehört, die der modernen Gesellschaft unheimlich werden, (anders als gentechnologisch veränderte Nahrungsmittel, in China gefertigte Säuglingsnahrung, Strahlung oder technische Geräte) wird diese universale, zunächst nicht so gemachte Dinglichkeit in dem Maße unheimlich, in dem sich die sozialen Erlebnismöglichkeiten gegenüber dem sozialen Zugriff verselbständigen.“ (Henkel, S. 239) „Unheimlichkeit“ – bei Henkel ein gern übernommener Begriff von Plessner – ist das, was eintritt, wenn man auf Organisationsanalyse verzichtet. So werden der Unheimlichkeit der weiteren Assoziationen kaum noch Grenzen gesetzt. „Grund und Boden“ führt zu „Nahrungsmitteln“, diese wiederum zu „Selbstgenuss“ und „Adipositas“. Von dort geht es weiter zur „Verantwortung“ und über Kants kategorischen Imperativ zur „Novelle des Berufsbildungsgesetzes von 2004“ – also zu einer „Rückerweiterung“ auf fast allen Ebenen.
Mit „Systemtheorien und Mensch-Umwelt-Forschung“ versuchen Kirsten von Elverfeldt und Heike Egner „eine geographische Perspektive“ zu liefern, so der Untertitel ihres Aufsatzes (S. 319-342). Ausgangspunkt ist die Zweiteilung der Geographie in einen natur- und einen sozialwissenschaftlichen Zweig sowie die Frage, wie man beide nach einer Phase des Auseinanderdriftens wieder annähern könnte. Als Wege dorthin werden gemeinsame Projekte, gemeinsame Methoden und die gemeinsame Nutzung von Theorien genannt (vgl., S. Egner, von Elverfeldt, S. 321). Im Folgenden konzentrieren die Autorinnen sich auf das letztere. „Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Prozess stellt dabei die Wahl hinreichend „großer Theorien“ dar, die zugleich eine große Chance der Verständigung über die Bruchlinie zwischen Sozial- und Naturwissenschaften hinweg darstellen könnte.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 322) Luhmanns Theorie sozialer Systeme soll stellvertretend für den sozialwissenschaftlich abzudeckenden Teil, Prigogines Theorie dissipativer Strukturen als naturwissenschaftliche Repräsentanz eingebracht werden. „Unser Ziel ist [...], über eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen Ausgangs- und Grundannahmen zu zeigen, dass eine Verknüpfung der beiden theoretischen Ansätze möglich ist. Dies hat aus unserer Sicht mehrere Vorteile: So können die Mensch-Umwelt-Beziehungen mit den beiden bekannten und vielfach geprüften Theorieansätzen in den Blick genommen werden, ohne dass Veränderungen am ursprünglichen Theoriesetting vorgenommen werden müssen, was zumeist auf Kosten der inneren theoretischen Kohärenz geschieht.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 324) Als Messlatte soll also das so genannte „Mensch-Umwelt“-Paradigma der traditionellen Geographie gelten, also eine „Rückerweiterung“ auf Uhlig (1970) oder noch ältere Arbeiten. Vorher hätte man allerdings prüfen müssen, ob dieses Paradigma in den jeweiligen Theorien überhaupt abbildbar ist. Aus systemtheoretischer Sicht kann es keine derart vereinfachten „Mensch-Umwelt-Beziehungen“ geben, denn die strukturelle Kopplung zwischen sozialen Systemen und Technik läuft meist über Unternehmen, also über Organisationen. Inwieweit Technik dann biotische, ökologische, oder meteorologische Grenzen gesetzt bekommt, wird politisch ausgehandelt – also ebenfalls in Organisationen. Die genannten Systemtypen sind völlig unterschiedlich konzipiert, weisen also auch entsprechend unterschiedliche System-Umwelt-Gefälle auf. Dabei kann „Umwelt an sich“ kein System sein. Ein System-Umwelt-Gefälle kann nur aus der Sicht eines bestimmten sozialen Systems thematisiert werden.
Egner und von Elverfeldt hätten eigentlich das „Mensch-Umwelt“-Paradigma über Bord werfen müssen, wenn es um angewandte Systemtheorie gehen soll. Doch genau das geschieht nicht. Stattdessen werden die „bekannten und vielfach geprüften Theorieansätze“ (Egner, von Elverfeldt, S. 324) entgegen dem oben zitierten Versprechen eben doch verändert und – demontiert. Auf dem Weg dorthin versteigen die Autorinnen sich zu der Behauptung, mit Luhmanns Systemtheorie ließe sich keine Umweltbildung betreiben. Angesichts der Tatsache, dass zumindest zwei größerer Arbeiten in der neueren Umweltbildung aus systemtheoretischer Geographie stammen (vgl. Klüter, Bastian 2012, Klüter 2015) und von Umweltverbänden genutzt werden (z.B. erneut in Beil, Kröger, Roloff 2015), dürfte die Behauptung absurd sein.
Ähnlich unverständlich ist die Handhabung des Organisationsbegriffs. Formale Organisation und ihre besondere soziale Funktion für Steuerungsprozesse ist einer der Kernbegriffe der Luhmannschen Systemtheorie. Egner und von Elverfeldt ordnen diesen Begriff Prigogine zu: „Bei Prigogine heißt diese Ordnung Organisation (oder Struktur); bei Luhmann wird die Ordnung durch Reduktion von Komplexität hergestellt [...].“ (Egner, von Elverfeldt, S. 329) Ebenso haarsträubend geht es weiter: „Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen liegt im Grad der Individualität der Systeme. Die Individualität autopoietischer Systeme ist absolut: Kommunikation, Gedanken, Zellteilung usw. können stets nur innerhalb des spezifischen Systems stattfinden, niemals außerhalb. Dies trifft beispielsweise auf die Konvektionsströme in einem Hurrikan nicht zu – hier ist die spezifische Kombination aus Aktivität und Struktur das Kriterium, das einem System Identität verleiht.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 332) Hier nähern sich die beiden Autorinnen bedenklich dem Niveau der bereits erwähnten Henkelschen Ausführungen. Doch schon bald wird es unterschritten: „Als Unterschied zwischen den beiden Theoriekonstruktionen bleibt festzuhalten, dass autopoietische Systeme prinzipiell autonom gegenüber ihrer Umwelt sind, während selbstorganisierende thermodynamische Systeme dagegen nur phasenweise autonom sind, da sie immer wieder Zustände der Stabilität erreichen können, in denen sie vollkommen durch ihre Rahmenbedingungen determiniert sind.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 334, 335) Von der angeblichen Autonomie sozialer Systeme schließen die Autorinnen auf schwierige Prognostizierbarkeit – womit Luhmanns Aussagen zu Kontingenz, Entscheidung, Systemzeit und Variation auf den Kopf gestellt werden. „Dieser theoretische Ansatz bedeutet jedoch mehr als nur die Aufgabe der Vorhersage [...]. Denn akzeptiert man Autopoiesis und Selbstreferenz als konstituierende Elemente von sozialen, psychischen und lebenden Systemen, führt dies zu dem Schluss, dass weder auf der gesellschaftlichen Ebene (soziale Systeme) noch auf individueller Ebene (psychische Systeme) von einer Art gemeinsamer Rationalität ausgegangen werden kann. Aus der Perspektive der luhmannschen Systemtheorie ist mithin das große Projekt der Aufklärung gescheitert, und dafür gibt es einige Evidenz [...].“ (Egner, von Elverfeldt, S. 336) Dieser Schluss erstaunt, zumal es Luhmann war, der 6 Bände „Soziologische Aufklärung“ verfasst hat. Man muss wohl davon ausgehen, dass die Autrorinnen keinen davon gelesen haben. Auf der folgenden Seite versuchen die Autorinnen, jenen Schluss zu rechtfertigen. Der Text liest sich wie eine Beschreibung der Ausgangssituation, die Luhmann in den frühen sechziger Jahren zur Systemtheorie veranlasste: Die Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilsysteme Politik, Recht, Wirtschaft, Kunst, Religion und Wissenschaft mit ihren jeweiligen Kommunikationsmedien oder Teilsprachen, die nicht mehr aufeinander zurückführbar sind, erzeugen Abweichungen voneinander. Luhmann antwortete darauf mit kontrollierten Strategien des Vergleichs, der funktionalen Äquivalenz, etwa analog der Übersetzung von Fremdsprachen bzw. von der einen Teilsprache in die andere. Darüber sind seitdem mehrere Regalmeter Bücher geschrieben worden, von denen offenbar keines das Bewusstsein der Autorinnen erreicht hat. Konsequenterweise landen sie in ihrem Fazit in systemtheoretischer Vorzeit: „Von den Vorstellungen der Machbarkeit von Veränderungen und der gezielten Steuerbarkeit natürlicher und sozialer Prozesse muss man sich vor diesen theoretischen Hintergründen verabschieden.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 338). Genau das Gegenteil zu erreichen – also neue Steuerungsmöglichkeiten aufzuzeigen –, war der Zweck der Systemtheorie. Hier dürfte nicht mehr Henkelsche „Rückerweiterung“, sondern eine längere Geisterfahrt in die Vergangenheit vorliegen. Das „Fazit: Natürliche und soziale Phänomene und die Beziehungen dazwischen“ (Egner, von Elverfeldt, S. 338, 339) zeigt die Trümmer: „Da unter Rückgriff auf Selbstreferenz und Autopoiesis erklärt werden kann, warum Gesellschaften bei aller Kenntnis der Folgewirkungen dennoch vermeintlich unverantwortlich handeln, ist dieser theoretische Unterschied für die Bearbeitung von Mensch-Umwelt-Beziehungen äußerst produktiv.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 338) Gesellschaften können nach Luhmanns Systemtheorie nicht handeln, denn das ist Organisations- und Interaktionssystemen vorbehalten. Wie in diesem Sammelband häufiger, wird das Technische (vgl. Ropohl 2009) außen vor gelassen.
Der Schlusssatz resümiert: „Aus dem Anschluss des einen Theoriegebäudes an das andere ergibt sich auf diese Weise ein produktiver Dreiklang: natürliche Phänomene, soziale Phänomene und die Beziehungen dazwischen.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 339). Damit landen die Autorinnen irgendwo zwischen Wirth’s alter Phänomenologie und dem phänomenalen Harmoniebedürfnis der Geographie vor 1968. Was Egner und von Elverfeldt als „geographische Perspektive“ (Untertitel) anbieten, ist nicht mehr als eine Geisterfahrt gegen zeitgemäße Theoriebildung.
Für den Sammelband ist es schlimm, dass das Buch auf diese Weise ohne ein mäßigendes Schlusswort oder einen Kommentar endet. Auch hätte man die um mehr Seriosität und Nachvollziehbarkeit bemühten, politologisch orientierten Arbeiten (Kjær, Kusche, Mascareño) den übrigen gegenüber hervorheben können.
Allerdings ist bereits der Anfang des Sammelbandes nicht unproblematisch. Man vermisst einen State of the art-Aufsatz. Er hätte möglicherweise verhindert, dass längst verfügbare Literatur (s.u.) ausgeblendet wurde, und dass die Autoren und Autorinnen mit völlig verschiedenen Informationsständen in die Diskussion eintreten. So ergibt sich ein teils lust-, teils konzeptionsloses Herumstochern in Systemtheorie. Letztere wird auf einige wenige, meist aus dem Theorie-Kontext isolierte Vokabeln reduziert, was jegliche Systematik vermissen lässt. Das Ganze wird mit unnötigen Ontologisierungen von Grenzen und Räumen (Redepenning), von Systemen und Netzwerken (Goeke, Zehetmair), vom „soziobiotechnischen Komplex“ (Lippuner) von Dingen und Dinglichkeit (Guggenheim, Henkel) und schließlich von Mensch-Umwelt-Beziehungen (Egner, von Elverfeldt) in meist vorwissenschaftlicher Heuristik garniert. Die „Rückerweiterung“ in altgeographische Phänomenologie bei Wirths, Egner und von Elverfeldt, die keineswegs mit Husserls anspruchsvollen philosophischen Ansätzen unter demselben Label verwechselt werden sollte, ist voreilig. Als Pseudo-Lösung kommt sie in diesem Sammelband nur deshalb zum Zuge, weil die meisten Autoren sich mit älteren hausbackenen Fragestellungen wie geographischen Grenzen, Stadt-Land-Gegensatz, verkehrsgeographischen Netzen, traditioneller Bodenpolitik, Physio-Humangeographie-Annäherung befassen. Interessanter wäre gewesen, wie mit neueren sozialwissenschaftlichen Ansätzen neue Fragestellungen für die Geographie erschlossen werden könnten. Doch die Angebote aus Luhmanns Organisationstheorie, aus den Strategien zur Bearbeitung funktionaler Äquivalenzen, aus den gesellschaftsbezogenen Überlegungen zur kommunikativen Erreichbarkeit und vieles andere blieben in dem Sammelband ungenutzt.
Die Anfangsabsicht, Lippuners Geographie sozialer Systeme zu verwerfen, war lange überfällig und sollte mit dem Sammelband hoffentlich gelungen sein. Das weitere Ansinnen, systemtheoretische Geographie durch eine wie auch immer geartete „allgemeine Ökologie der Gesellschaft“ zu ersetzen (vgl. Goeke, Lippuner, Wirths, S. 5), die offenbar „soziobiotechnische Komplexe“ (Lippuner, S. 305) zu untersuchen hätte, wurde erfolgreich ad absurdum geführt.
Literatur
Baecker, Dirk 2005: Form und Formen der Kommunikation. Frankfurt a. M.
Baecker, Dirk 2011: Technik und Entscheidung. In Erich Hörl (Hg.): Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt. Frankfurt a. M. 179-192.
Bateson, Gregory 1981: Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt a. M.
Bateson, Gregory 1982: Geist und Natur. Eine notwendige Einheit. Frankfurt a. M.
Beil, Thomas, Jörg Kröger, Burkhard Roloff (Hg.) 2015: Aktionsprogramm Nachhaltige Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 2015. Schwerin. http://www.bundmecklenburg-vorpommern.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvmeckpomm/pdf/APnLW-Broschuere-komplett.web.pdf
Bommes, Michael, Veronica Tacke 2006: Das Allgemeine und das Besondere des Netzwerkes. In Betina Hollstein, Florian Straus (Hg.): Qualitative Netzwerkanalyse. Wiesbaden. 37-62.
Crutzen, Paul J., Eugene F. Stoermer 2000: The „anthropocene“. Global Change Newsletter 41, 17-18.
Döring, Jörg, Tristan Thielmann (Hg.) 2008: Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld.
Döring, Jörg, Tristan Thielmann (Hg.) 2009: Mediengeographie. Theorie, Analyse, Diskussion. Bielefeld.
Fuchs, Peter 2004: Der Sinn der Beobachtung. Begriffliche Untersuchungen. 2. Aufl. Weilerswist.
Klüter, Helmut 1986: Raum als Element sozialer Kommunikation. Giessen (Giessener Geographische Schriften 60).
Klüter, Helmut 1987: Räumliche Orientierung als sozialgeographischer Grundbegriff. Geographische Zeitschrift 1987. Heft 2, 86-98.
Klüter, Helmut 1999: Raum und Organisation. In: Peter Meusburger (Hg.): Handlungsorientierte Sozialgeographie. Benno Werlens Entwurf in kritischer Diskussion. Stuttgart. 187-212.
Klüter, Helmut 2002: Raum und Kompatibilität. Geographische Zeitschrift 90, 2002. Heft 3 + 4, 142-156.
Klüter, Helmut 2003: Raum als Umgebung. In: Peter Meusburger, Thomas Schwan (Hg.): Humanökologie. Ansätze zur Überwindung der Natur-Kultur-Dichotomie. Stuttgart (Erdkundliches Wissen 135). 217-238.
Klüter, Helmut 2006: Ein systemtheoretischer Ansatz in der Humangeographie. In: Raimund Rödel, Klaus D. Aurada (Hg.): Beiträge zum 16. Kolloquium Theorie und quantitative Methoden in der Geographie. Greifswald (Greifswalder Geographische Arbeiten 39). 25-38. http://www.yepat.uni-greifswald.de/geo/fileadmin/dateien/Publikationen/GGA/GGA_39_Roedel.pdf; abgerufen am 24.03.2015.
Klüter, Helmut, Uwe Bastian 2012: Gegenwärtige Strukturen und Entwicklungstendenzen in der Brandenburger Landwirtschaft im Ländervergleich. Greifswald. http:// www.landtag.brandenburg.de/de/aktuelles/bildergalerie_2012/ 23._sitzung_der_enquete-kommission_5/1_am_24.08.2012/567402, abgerufen am 05.02.2015.
Klüter, Helmut 2015: Die Landwirtschaft in Sachsen im Vergleich mit anderen Bundesländern. Endbericht. Dresden. https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/ user_upload/Studien/Landwirtschaftsstudie_web_2015-01.pdf; abgerufen am 05.02.2015.
Kneer, Georg 2009: Jenseits von Realismus und Antirealismus. Eine Verteidigung des Sozialkonstruktivismus gegenüber seinen postkonstruktivistischen Kritikern. Zeitschrift für Soziologie 38 (1), 5-25.
Krämer-Badoni, Thomas, Klaus Kuhm (Hg.) 2003: Die Gesellschaft und ihr Raum. Raum als Gegenstand der Soziologie. Opladen.
Kuhm, Klaus 2003: Was die Gesellschaft aus dem macht, was das Gehirn dem Bewusstsein und das Bewusstsein der Gesellschaft zum Raum ‚sagt‘. In Thomas Krämer-Badoni, Klaus Kuhm (Hg.): Die Gesellschaft und ihr Raum. Raum als Gegenstand der Soziologie. Opladen. 13-32.
Latour, Bruno 2012: Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des modernes. Paris. Deutsch: Existenzweisen. Eine Anthropologie der Moderne. Berlin 2014.
Lippuner, Roland 2007: Kopplung, Steuerung, Differenzierung zur Geographie sozialer Systeme. In: Erdkunde 61, 174-185.
Meusburger, Peter, Thomas Schwan (Hg.) 2003: Humanökologie. Ansätze zur Überwindung der Natur-Kultur-Dichotomie. Stuttgart (Erdkundliches Wissen 135).
Neves, Marcelo 2006: Die Staaten im Zentrum und die Staaten an der Peripherie: Einige Probleme mit Luhmanns Auffassung von den Staaten der Weltgesellschaft. Soziale Systeme 12 (2), 247-273.
Ropohl, Günter 2009: Allgemeine Technologie. Eine Systemtheorie der Technik. 3. überarbeitete Auflage. Karlsruhe. www.oapen.org/download?type=document&docid=422388 abgerufen am 05.02.2015.
Sack, Robert D. 1986: Human Territoriality. Its Theory and History. Cambridge u. a.
Stichweh, Rudolf 2003: Raum und moderne Gesellschaft. Aspekte der sozialen Kontrolle des Raums. In: Thomas Krämer-Badoni, Klaus Kuhm (Hg.) 2003: Die Gesellschaft und ihr Raum. Raum als Gegenstand der Soziologie. Opladen. 93-102.
Stichweh, Rudolf 2008: Kontrolle und Organisation des Raums durch Funktionssysteme der Weltgesellschaft. In: Jörg Döring, Tristan Thielmann (Hg.) 2008: Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld. 149-164.
Uhlig, Harald 1970: Organisationsplan und System der Geographie. In: Geoforum 1, 1952.
Quelle: geographische revue, 16. Jahrgang, 2014, Heft 2, S. 83-103
zurück zu raumnachrichten.de
