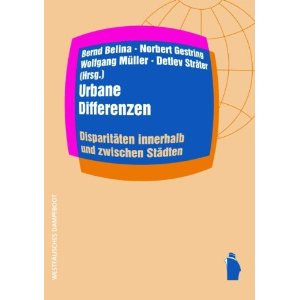 Sabine Motzenbäcker:
Sabine Motzenbäcker:
Don't get mad, get even: „Urbane Differenzen" im „Unbedachten Wohnen"
Rezension von:
Bernd Belina et al. (2011): Urbane Differenzen. Disparitäten innerhalb und zwischen Städten. Münster.
Jürgen Hasse (2009): Unbedachtes Wohnen. Lebensformen an verdeckten Rändern der Gesellschaft. Bielefeld.
Noch bis vor kurzem pflegten die Begriffe Hartz IV, Ghettoisierung und Standortkonkurrenz die öffentliche Diskussion um soziale Ungleichheit zu bestimmen. Seit aber eine neue Linkspartei (Die LINKE) aus der Hartz IV-Problematik erwachsen, das Gespenst der Ghettoisierung nach amerikanischem Muster im Migrationshintergrund abgetaucht ist, und Standortkonkurrenz dem Übergreifen der Schuldenkrise Platz gemacht hat, findet eine neuerliche Verschiebung der diskursiven Rahmung sozialer Ungleichheit statt.
Noch lassen sich die Konturen dieser Umformung nur undeutlich erfassen. Dennoch würde ich von unlängst erschienenen Publikationen zur Problematik „sozialräumlicher Disparitäten" Hinweise zur Erhellung neuer gesellschaftlicher Entwicklungen erwarten, zumindest aber ein Befragen danach, was denn nun das Besondere, oder, wenn man so will: das Neue, gegenwärtiger Prozesse sozialer Ungleichheit sei. Dieser Anspruch speist sich nicht aus vordergründigem Interesse an aktualistischen Interpretationen oder vorschnellen Trendanalysen, sondern aus der Notwendigkeit, gerade stattfindende Entwicklungen zu identifizieren, einzuordnen und zu verstehen, und deren Tragweite innerhalb und jenseits der Wissenschaft abzuschätzen. „Erkenne die Lage," hatte uns Gottfried Benn aufgegeben, „Rechne mit deinen Defekten. Gehe von deinen Beständen aus, nicht von deinen Parolen" (Benn 1949).Ketzerisch könnte man auch sagen, dies sei eine Frage der Relevanz. Gewiss, die Welt mag sich immer verändern, und so ist denn auch ein 'state of the art'-Buch bzw. ein Update vorherrschender Entwicklungen Grund genug zur Veröffentlichung. In den beiden hier zu besprechenden Büchern werden nun Problemfelder sozialräumlicher Disparitäten inhaltlich fortgeführt, neue Zusammenhänge oder Verschiebungen des Problemhorizontes werden indes nicht argumentativ erschlossen. Das ist bedauerlich, aber vielleicht symptomatisch für den gegenwärtigen Stand geographischer Ungleichheitsforschung.
„Urbane Differenzen", herausgegeben von Bernd Belina, Norbert Gestring, Wolfgang Müller und Detlev Sträter, ist aus der Aktivität des Arbeitskreises Kritische Regionalwissenschaft entstanden und betrachtet aus der Perspektive der Politischen Ökonomie Disparitäten zwischen und innerhalb von Städten. Trotz dieser Zusammenkunft in kritischer Absicht drängt sich beim Lesen der Einleitung aber der Verdacht auf, dass allzu viel an gemeinsamer Diskussion, die imstande gewesen wäre, die verschiedenen Beiträge der Autoren in einem übergreifenden Problemaufriss zusammenzubringen, nicht stattgefunden haben kann. Unlängst wurde ja auch in einem Versuch herausgefunden, dass man im stillen Kämmerlein allein vor sich hin denkend doch auf 'innovativere' Gedanken kommt als in der Gruppe (vgl. New York Times, 12. January 2012). Werden also Gruppendiskussionen bezüglich ihrer Fähigkeit Denkprozesse in Gang zu setzen doch systematisch überschätzt?

In seinem Buch „Unbedachtes Wohnen. Lebensformen an verdeckten Rändern der Gesellschaft" problematisiert Jürgen Hasse in einem Rückgriff auf die Schriften des einsamen Schwarzwaldhüttlers Heidegger jenes so geschätzte stille Kämmerlein. Mit seiner Untersuchung des Phänomens „Wohnen" will er diesen Denkort grundsätzlich in Frage stellen. Dieser Impetus des 'Mensch bedenke dass Du wohnst!' ist zwar heute wie zu allen Zeiten gerechtfertigt, sagt uns aber trotz der aktuellen Empirie der Studie wenig über die Problematik heutiger Wohnformen. Bei so viel bedachter Eigentlichkeit des Wohnens soll zum Ausgleich doch ein Zitat der Heideggerschülerin Hannah Arendt angeführt sein: "Denn im Unterschied zu dem, was man sich gemeinhin unter der souveränen Unabhängigkeit der Denker vorstellt, vollzieht sich das Denken keineswegs in einem Wolkenkuckucksheim, und es ist gerade was politische Bedingungen anlangt, vielleicht so verletzbar wie kaum ein anderes Vermögen" (Arendt 1967: 317). Über die Verletzbarkeit des Denkens im Wohnen erfährt man einiges, hingegen über das, was die politischen Bedingungen desselben anbelangt, wenig. Sowohl Hasse als auch Belina et al. liefern Antworten auf Fragen, die sich der Leser selbst erst noch eröffnen muss. So treiben beide hier diskutierten Titel, ob gewollt oder ungewollt, ihre Themen ins Fragwürdige und der Leser, der ja doch auch wissen will, warum er das jetzt lesen soll, sieht am Ende betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Wir kennen ja Marcel Reich-Ranickis gewohnte Abschiedsformel.
So what?
Die zwei Bücher behandeln das Thema sozialer Ungleichheit auf grundlegend verschiedene Weise und eigentlich auch nur hinter vorgehaltener Hand. Während der von Belina et al. herausgegebene Band in seinem Titel „Urbane Differenzen" auf postmodern konnotiertes Vokabular anspielt, dann aber doch stramm polit-ökonomisch, kapitalismuskritisch loslegt, hegt das Buch von Jürgen Hasse den Anspruch, randständige Wohnwelten sichtbar zu machen und in der Perspektive der „Neuen Phänomenologie" zu hinterfragen. Der orientierungsbedürftige Leser stößt denn auch in der Einleitung des erstgenannten Bandes auf ein paar Marx/Engels-Zitate, während Hasse mit Sätzen wie: „Vielmehr treibt sie [die intendierte Revision] dessen [des Wohnens] Noch-nicht-Bedenken über seine Verfremdung durchs Exotische ins Stutzen und schließlich in die Fragwürdigkeit" (Hasse 2009: 20) erkennbar an heideggernden Sprachstil anknüpft. Genau da liegt nun aber der Hase im Pfeffer oder der Hund begraben: Die jeweiligen Autoren bleiben in ihrer scheinbar grundlos angenommenen theoretischen Perspektive gefangen, ohne einen Problemhorizont, wie z. B. soziale Ungleichheit, urbane Entwicklung oder Wohnungsbaupolitik zu entwerfen, vor dem diese Herangehensweisen relevant wären. Man vermeint einhändiges Klatschen zu hören und fragt sich, woher der Klang kommt.
Noch einmal: Was wollen uns diese Publikationen sagen? Die Einleitung von Belina et al. gibt zur Rechtfertigung der Fragestellung wenig bis keine Hinweise. Nachdem dem Leser originellerweise angedient wird, Disparitäten sowohl innerhalb als auch zwischen Städten zu diskutieren, versäumen es die Herausgeber, dieses Problem auf irgendeine Weise schmackhaft zu machen. So bleibt denn auch die in der Einleitung vorzeitig gegebene Erklärung städtischer Disparitäten verdächtig allgemein: einmal ist dafür Boden- und Immobilienmarkt, ein andermal die lokale Politik verantwortlich. Hier wird nichts ins Fragwürdige gestürzt, weswegen die vorgebrachten Antworten als Ausdifferenzierungen des Bekannten erscheinen müssen. Dies ist eine Art, Neues zu verschleiern, soziale Widersprüche kapitalistischer Gesellschaften analytisch stillzulegen und somit als räumliche Differenzen vor allem das aufzuzeigen, was als klassisches Tableau sozialer Konflikte gilt: Rasse, Klasse und die globale Dynamik der Kapitalakkumulation. Genderfragen, immerhin ein nicht unwesentlicher Komplex sozialer Konflikte, spielen hier offensichtlich keine Rolle. Soziale Ungleichheit, oder wenn man so will sozialräumliche Disparität, erscheint hier als abstrakter, diskriminierender Effekt, der sich immer im Rücken der Akteure abspielt, sozusagen 'von bösen Mächten unheilvoll umgeben'. Vorne aber steht Hasse und ruft: "Wen es auf der einen Seite auszuschließen scheint, dessen nimmt es sich auf der anderen Seite wieder an" (Foucault 1975:67, zitiert nach Hasse 2009: 67), in diesem Falle des lebendigen Ausdrucks, der Gestalt der Dinge, die Belina et al. so nonchalant durch Mechanismen ersetzen.
Der Versuch, „tragfähige Wege aufzuzeigen, sich mit diesen [sozialräumlichen Unterschieden in der Stadt] wissenschaftlich und politisch auseinanderzusetzen" (Belina et al. 2011: 9), verläuft daher in höchst ungewissen Bahnen: von hinten durch die Brust ins Auge. Ob dieses Ziel der tragfähigen wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzung erreicht wird, muss leider offen bzw. dem Leser anheim gestellt bleiben, da auch ein editorisches Schlusskapitel fehlt. Hier wäre zu wünschen, dass der Arbeitskreis Kritische Regionalwissenschaft doch noch einmal reflektorisch aktiv wird, und die von der Einleitung noch heiße Nadel mit kühlem Kopf ins allzu lose Strickwerk fahren lässt. Unklar bleibt in der Einleitung nämlich vor allem, wie sich denn urbane Differenzen, die ja durchaus begrüßenswert sind und in gewisser Weise gerade das Urbane ausmachen, in Disparitäten übersetzen. Das wäre mal eine interessante Wendung postmodernistischen Differenzvokabulars ins Polit-ökonomische gewesen und hätte womöglich auch Anschluss an eine Debatte gefunden, die sich ja nicht umsonst gerade auf dem Überschneidungsfeld von Stadtentwicklung und sozialer Ungleichheit austobt (vgl. Dorling/Shaw 2002, Mohan 2002 u. 2000, Cameron 2005 u. 2006, Soja 2010), und uns ins Zentrum der Diskussionen um den cultural turn hätte führen können. Und gerade an diesem Rand gibt es durchaus interessante Weiterentwicklungen polit-ökonomischer Analyse, die sich als post-marxistisch verstehen (z. B. Ernesto Laclau) oder wie Andrew Merrifield jüngst titelte, einen „Magical Marxism" jenseits von strukturalistischen Gewissheiten anregen wollen.
Ganz anders geht hier das Buch von Hasse vor. Ihm ist das Fragwürdigmachen des selbstverständlichen Alltagsphänomens Wohnen Ausgangspunkt einer Studie, die das wohnende Subjekt in seinem Selbstverständnis des In-der-Welt-Seins problematisiert. Insofern kann es keine vorgefertigte Erklärung bestehender Wohnformen geben. Entsprechend entfalten einleitendes und abschließendes Kapitel durchaus beträchtliches theoretisches Potential in ihrer Befragung einer in Zweisamkeit und Ortsgebundenheit quasi mythischen Vorstellung des Wohnens. Zentral sind hier Heideggers Metapher der 'Schonung' und des Wohnens im 'Geviert' sowie Foucaults Technologien des Selbst, die das Wohnen von seiner unhinterfragten Behaglichkeit der umgrenzten Behausung ins Bewusstsein rücken als ein von gesellschaftlichen, leiblichen und atmosphärischen Kräften durchzogenes Dispositiv der Macht. Der geneigte Leser schauert ergriffen bei dieser Conclusio, denn gerade das Gesellschaftliche (ganz zu schweigen vom Politischen) hat sich in der Darstellung des Leiblich-Atmosphärischen fast vollständig verflüchtigt.
Insofern ist seine erklärende Perspektive spiegelbildlich zu Belina et al. organisiert. Hier wird der Möglichkeit und der Entfaltung von Wohnen in seiner sinnlichen Wahrnehmbarkeit nachgespürt, während bei Belina et al. abstrakte Prozesse im Vordergrund stehen. Aber auch Hasse betrachtet soziale Ungleichheit nur implizit als Mittel zum Zweck des Fragwürdigmachens, so wie Belina et al. sich uneinig bleiben, ob sie nun Differenzen oder Disparitäten aufzeigen wollen. Bei Hasse also durch die Hand gesprochen: „Das Ästhetische erweist sich damit als prädestiniertes Dispositiv der Macht, das sich über die subtilen Kräfte sozialer Ein- und Ausgrenzung realisiert. Im Wohnen erkennen sich die Menschen untereinander und gegeneinander. In Zeiten sich verschärfender sozioökonomischer Spaltungen der Gesellschaft fungiert das Ästhetische auch als Medium der Segregation" (Hasse 2009: 32, Hervorh. S. M.). Der Gehalt einer relevanten Gegenwartsanalyse geht jedoch über die Feststellung von ortslos gewordenen Praktiken der Ästhetisierung nicht hinaus. Hasse will ja auch an Grundsätzliches rühren, dessen Selbstverständlichkeit eigentlich nur da aufgebrochen und sichtbar gemacht werden kann, wo sich bereits Risse zeigen. Die Frage, wo die Risse herrühren, liegt indes außerhalb seines Gesichtsfeldes.
Differenzgang
In Ermangelung ausbuchstabierter Rechtfertigungszusammenhänge wählen beide Publikationen die inhaltliche Anordnung eines Rundgangs. Dieses Abschreiten städtischer Differenzmodule wirkt bei Belina et al. jedoch systematischer als es ist. Es ist ein Kessel Buntes, dem die Mühen des Ordnens noch anzumerken sind. Belina/Gestring/Müller/Sträter klopfen der Reihe nach erst Gründe und Formen, dann Politik und Regierung innerstädtischer Disparitäten ab, sodann behandeln sie Disparitäten zwischen Städten. Im ersten Block der Ursachenklärung sozialräumlicher Disparitäten kritisiert Hans-Joachim Bürkner den zunehmend kulturalistischen Diskurs über räumliche Erscheinungsweisen sozialer Ungleichheit als Stellvertreterdiskurs, der strukturelle Ursachen sozialer Spaltungen verdecke. Alternativ schlägt er eine verräumlichte Intersektionalitätsforschung vor, die nun aber nicht gedacht ist als eine Art multivariater Analyse, die neben kulturellen und strukturellen Faktoren der Diskriminierung nun eben auch räumliche berücksichtigt, sondern diese zum eigentlichen Kern der Untersuchung machen will, als Beforschung der Intersektionalitätsvarianten in situ" (Bürkner 2011: 33) sozusagen. Neben diesen „konkreten sozialen, ökonomischen und räumlichen Kontexten" sollen dann die „Situationsdeutungen der Minderheiten" (ebd.: 36) auch noch berücksichtigt werden. Sicherlich würde dies die Einseitigkeiten diskriminatorischer wie affirmativer kulturalistischer Diskurse aufweichen, fraglich ist aber, ob eine differenziertere Betrachtung räumlicher Kontexte, in denen sich verschiedene Kontexte auf spezifische Weise überlagern, die räumlich distinkten Ausdrucksformen sozialer Ungleichheit erklären kann. Es gälte hier insbesondere einen Fallstrick der humanökologischen Schule zu vermeiden nach dem räumliche Charakteristika lediglich die „Umgebung" darstellen, in der soziale Aktivitäten stattfinden. Intersektionalität in situ zu betrachten, legt aber genau das nahe.
Weiter geht es dann in diesem Block mit einem Artikel von Holger Floeting, Dietrich Henckel und Josiane Meier, einem Trio, das sich auf den verschiedenen Hierarchiestufen des akademischen Betriebes, im Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin zusammengefunden hat, um Arbeitsmärkte zwischen Globalisierung und Lokalisierung zu untersuchen. Manch einer erinnert sich wohl noch an einen der vergangenen Geographentage unter dem Motto „lokal verankert, weltweit vernetzt"(1999). In diesem Beitrag nun, immerhin dreizehn Jahre später, geht es immer noch um dieses Ominöse zwischen Globalisierung und Lokalisierung, in diesem Falle bezogen auf den Arbeitsmarkt. Entsprechend befinden wir uns in einem Bedeutungshof, in dem Begrifflichkeiten wie 'Informations- und Wissensgesellschaft', 'höhere Durchlässigkeit von Grenzen', 'innovationsfreundliche Stimmung' und 'Existenzgründung' eine tragende Rolle spielen. Das dazu passende geographische Vokabular bewegt sich zwischen Polarisierung, Verdichtung, Nähe und Distanz sowie natürlich Entgrenzung und Einbettung. Im Unterschied zu damals sind diese Begriffe nun aber mit weniger erfreulichen Nebenwirkungen belastet wie 'informelle Beschäftigung', 'Scheinselbständigkeit' und 'Prekarität', außerdem: 'demographischer Wandel' und 'Buntheit der Bevölkerung' (Floeting/Henckel/Meier 2011: 65). An der Kurpackung für die kommunale Politik bestehend aus einer Mischung von wissensorientierter Wirtschafts- und Stadtentwicklungspolitik, integrierter lokaler und regionaler Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sowie Förderung der Selbständigkeit hat sich indes nicht viel geändert. Hier wäre den Autoren zuzustimmen, dass angesichts der Gleichzeitigkeit von Arbeitskräftemangel und hoher Arbeitslosigkeit, wie sie ja treffend diagnostizieren, „es wieder an der Zeit wäre, einen strategischen Ansatz im kommunalen Umgang mit lokalen Arbeitsmärkten zu entwickeln" (ebd.: 64). Offenbar haben die Autoren hier eine stärker nachfrageorientierte Politik im Sinn, die auf die Bereiche Bildung, demographischer Wandel und Migration abzielt. Eine Strategieänderung gegenüber den Schröder'schen Arbeitsmarktreformen verspricht dies aber kaum.
Als letztes folgt in diesem Block ein Beitrag von Klaus Brake zur These der „Reurbanisierung", wiederum betrachtet im Kontext wissensintensiver Ökonomie, der dazu dienen soll das „Gerede" von einem Bedeutungsgewinn der Städte substanziell abzusichern. Die behauptete Raumbindungskraft von Städten wird dabei an der Stadtaffinität flächennutzender Aktivitäten fest gemacht, hier insbesondere der Generierung von „noch bedeutend aggressiveren Vorsprüngen an Wissen" (Brake 2011: 75). Die angenommene geographische Bandbreite der verschiedenen Aktivitäten wissensintensiver, kreativer Ökonomien bewegt sich wiederum zwischen Globalisierung und Lokalisierung, bzw. zwischen Dispersion und Konzentration. Dabei erlaubten es die Vorteile räumlicher Nähe, urbaner Milieus und kernstädtischer Rückbettung von Reurbanisierung als mittelfristiger Tendenz zu sprechen. Interessant ist, dass Brake hier sogar von einer „Zwangslogik" spricht, die den Akteuren „Arbeits- und Lebensformen einer Anregungsdichte als Katalysator für neue Ideen bzw. Wissensvorsprünge und einer unabdingbaren Work-Life-Balance aufherrscht" (Brake 2011: 82). Entsprechend gäbe es für die Städte des europäisch-atlantischen Strukturtyps keine Alternative, als sich mit dieser unbestechlichen Logik auseinanderzusetzen.
Damit einhergehende desintegrative Entwicklungen wie zunehmende Polarisierung, Selektivität, Gentrifizierung, Segregation, Aggressivität und Konflikthaftigkeit von Stadtentwicklung, die Brake als kritischen Gegenpol dieser Entwicklung anführt, müssten ebenso wie die Maximen der Wissensökonomie im Konzept der Metropolregionen im Rahmen der Lissabon-Strategie der EU, in der Kohäsionspolitik und insbesondere in der Bildungspolitik dünn besiedelter Gebiete Berücksichtigung finden. Auch für urbane Zentren scheinen wir definitiv am Ende der Gemütlichkeit angelangt, wenn der harmlose Flaneur des 19. Jahrhunderts nun als „Egoist der Stadtaneignung" (Brake 2011: 88) auftritt. Da heißt's also: Kapuze hoch, Nadelstreifen stramm und Visier runter, bevor's rein geht ins Milieu.
Wir sind schließlich beim zweiten Themenblock städtischer Disparitäten angelangt: Politik und Regierung. Immerhin wird dieses Thema von der einzigen Autorin des Bandes eröffnet. Wenn Gender-Themen schon nicht opportun sind, tut's ja bisweilen auch ein Artikel über Natur. Marit Rosol beschäftigt sich also mit dem Stadtgrün. Verwundert stellt sie fest, dass gegenüber den 1970er und 80er Jahren der ungleiche Zugang zu städtischen Freiflächen kaum noch thematisiert wird. Offensichtlich ist dies vor allem dem Abbruch der hannoverschen Traditionslinie sozialwissenschaftlicher Planungstheorie um Ulfert Herlyn geschuldet. Zur Wiederauffrischung der Debatte geht Rosol nun besonders auf zwei Arbeiten aus diesem Umfeld ein, die bezüglich Sprachduktus und Differenziertheit der Argumentation doch leichte Reminiszenzen wecken an Zeiten als an Mensaaufgängen noch Flugblätter mit ausschließlich in Kleinbuchstaben verfassten Bleiwüsten verteilt wurden. Wer so schrieb, war vom Humor der Seyfried-Comics gänzlich unberührt, und meinte es sehr, sehr ernst. Man könnte dies durchaus zum Anlass nehmen, dem heute so eingeschliffenen kritischen Diskurs der Neoliberalisierung den Spiegel vorzuhalten.
Leider versäumt es die Autorin aber auch, diese Arbeiten einzuordnen und für ihre weitere Untersuchung kritisch reflektierend zu nutzen. Stattdessen sucht sie den Schulterschluss: Die Ursachen sozialer Ungleichheit in der Freiraumversorgung werden an „vertikaler (ökonomischer) sowie horizontaler (politischer) Ungleichheit und in den Mängeln in Anspruch und Aufgabenstellung der kommunalen Freiraumplanung" (Rosol 2011: 105) fest gemacht. Entsprechend fällt die Antwort zu der aufgeworfenen Frage, ob denn Gemeinschaftsgärten als „selbstbestimmte, kollektive Formen der Freiraumplanung eine Chance bieten, diesen strukturellen Disparitäten auszuweichen" (ebd.: 105), negativ aus. Wieder profitierten vor allem Mittelschichtsangehörige, und Gemeinschaftsgärten wirkten tendenziell sogar selbst exkludierend. Im heutigen Kontext des aktivierenden Staates, der Verbetriebswirtschaftlichung der Grünflächenämter, der Reduzierung kommunaler Verantwortung für öffentliche Infrastruktur und der Annahme eines veränderten Stellenwertes von städtischen Freiflächen für die Freizeitgestaltung der Stadtbevölkerung plädiert die Autorin für ein umfassenderes Konzept zum Abbau der Ungleichheiten in der Freiraumversorgung. Man kann nur ahnen, wohin das gehen soll.
Rosol greift ein äußerst wichtiges Problemfeld städtischer Planung auf, verbaut sich jedoch durch einen unkritischen Blick zurück auf die 'Glanzzeiten' polit-ökonomischer Analyse die Möglichkeit, städtische Grünflächenversorgung auch im Kontext jüngerer Auseinandersetzungen um öffentliche Infrastruktur wie z. B. Stuttgart 21 zu sehen. Nicht umsonst hieß ja dort eine der aktivsten Protestgruppen „Parkschützer"! Das angemahnte „umfassendere Konzept" zeigt sich womöglich weniger in der Vergangenheit als auf den Straßen und Plätzen, wo sich Stadt im Hier und Jetzt angeeignet wird (vgl. z. B. Jäger/Seibert 2012).
Weiter geht es nun mit einem Artikel von einem der Herausgeber. Mit Anklang an Gouvernementalitätsstudien, und hier insbesondere der Arbeit von Jonathan Simon (2007) Governing through Crime, erläutert Bernd Belina, wie städtische Disparitäten durch die
Inszenierung von Kriminalität erzeugt werden. Allerdings verhallt dieser Anklang genauso schnell und beiläufig wie er angeschlagen wurde. Beabsichtigt ist hier weniger eine Foucault'sche Diskursanalyse als eine Ideologiekritik der räumlichen Differenzierung der materialen Ausformungen des Strafrechts. Dies weise nämlich einen gesonderten Legitimationsbedarf auf, weil es wie alle in Rechtsform gegossenen Prinzipien von sozial hergestellten Unterschieden zwischen Rechtssubjekten und deren schuldhaften Verstrickungen absehen muss, gleichzeitig aber die vorausgesetzte A-Räumlichkeit des Rechts innerhalb des Geltungsbereichs des nationalen Territoriums unterläuft.
Belina erweitert also vordergründig den Ansatz von Simon (2007) zu „Governing through Crime through Space", verfolgt aber eine völlig andere Argumentation. Entlarvend wird an den Beispielen der Videoüberwachung öffentlicher Räume, von Platzverweisen, Betretungsverboten und Verbringungsgewahrsam, gefährlichen Orten und des gescheiterten Alkoholverbots im öffentlichen Raum gezeigt, dass es sich bei der Verhinderung von Straftaten durch die Regierung von Räumen mittels Strafrecht um einen Mythos handelt. Vielmehr sei das unausgesprochene Ziel die Durchsetzung einer bestimmten Vorstellung öffentlicher Ordnung, in der die wachsenden Armuts- und Elendsbevölkerungen in der Stadt sortiert und versteckt werden sollten. Außerdem würden konkrete Gefährdungen vor Straftaten zu abstrakten Gefahrenlagen in bestimmten Räumen uminterpretiert und somit der polizeiliche Zugriff ins Unbestimmbare erweitert. So kann an gefährlichen Orten ganz legal eine intensivere Kontrolle bestimmter unerwünschter Personengruppen durchgeführt werden, ohne dass dies einer besonderen Rechtfertigung bedürfte. Interessanterweise konnte eine Erweiterung dieses Verbots auf Alkoholkonsum an bestimmten Orten rechtlich nicht durchgesetzt werden, da diese Droge ja grundsätzlich legal ist.
Dennoch sei die rein juristische Eindämmung dieser Überwachungspraxis nur begrenzt erfolgversprechend, da es sich hier um exekutiv dominierte legislative Entscheidungen handelt. Schließlich müssten, so Belina, rechtliche Kämpfe immer an soziale Kämpfe rückgebunden bleiben, also den Auseinandersetzungen um die Produktion sozialräumlicher Disparitäten. Hierzu müsste wohl auch die von Belina anvisierte Ideologiekritik über rechtliche Regelungen hinausgehen und Vorstellungen über gesellschaftliche Ordnung und öffentlichen Raum einbeziehen. Allerdings müsste dann deutlicher gemacht werden, wie eine Ideologie funktioniert, was ihre besonderen Merkmale sind und was durch sie verschleiert wird, um nur einige Probleme der Ideologiekritik anzuführen.
Gerade im Hinblick auf die verschleiernde Steuerung gesellschaftlicher Prozesse scheint mir der darauf folgende Beitrag von Wolfgang Müller und Detlef Sträter zur Aushebelung kommunaler Selbstverwaltung in diesem Band am interessantesten. Der Beitrag kontextualisiert bereits länger wirkende Gefährdungen kommunaler Selbstverwaltung wie die Verlagerung von Entscheidungsprozessen von kommunalen Organen repräsentativer Demokratie zur kommunalen Administration sowie auf übergeordnete Ebenen von Land, Bund und EU und zu privaten Trägern. So wurden den Kommunen mehr und mehr staatliche Aufgaben übertragen, deren Finanzierung sie allerdings immer weniger gewährleisten können. Innerhalb der Kommunen fand außerdem eine Professionalisierung und Autonomisierung der Stadtverwaltung gegenüber dem Stadtrat statt, der sich seinerseits durch die Parlamentarisierung seiner Tätigkeit verstärkt Parteizielen untergeordnet hat.
In diesen Entwicklungen zeigt sich, wie das neoliberale Gerede von 'weniger Staat' und Bewahrung vor einseitiger politischer Einflussnahme tatsächlich zu mehr Staat und mehr Bürokratie führt, während essentielle Aufgaben der städtischen Daseinsvorsorge im Zuge von Privatisierungen in die Hände einzelwirtschaftlicher Interessen gelegt werden. Müller/Sträter sprechen hier von einem neuen Modell politischer Steuerung von Städten und Gemeinden, in dem politische Ziele durch unternehmerische Zielvorgaben ersetzt würden (Müller/Sträter 2011: 151). Gleichzeitig fände eine Neudefinition des Öffentlichen statt, die den Bereich des Privaten zu erweitern suche und den politischen Raum demokratischer Einflussnahme begrenzen wolle. Der lokale Staat fände sich solchermaßen gefangen zwischen der Aufgabe, für Transparenz und demokratische Kontrolle zu sorgen und andererseits in Aufsichtstätigkeiten kommunaler Unternehmen der gesetzlich geregelten Geheimhaltungspflicht zu folgen.
Diese Entwicklungen zeigen, wie die andernorts geführte Rede von stärkerer Bürgerbeteiligung, wenn es sich dabei um andere als unternehmerische Interessen handelt, zu verstehen ist. Die Grenzen zur Korruption sind hier nicht mehr klar, und, wie das jüngste Beispiel des zurück getretenen Bundespräsidenten Wulff zeigt, für die Beteiligten bisweilen erst durch öffentlichen Druck einsichtig zu machen. Zusammen mit den Protesten um Stuttgart 21 und ähnlichen Protesten gegen öffentliche Infrastrukturprojekte in Hamburg, Köln, Bonn und Leipzig, auf die Müller/Sträter hinweisen, könnte dies darauf hindeuten, dass hier in zaghaften Ansätzen eine neue „bürgerliche" Gegenwehr entsteht, die zumindest in Einzelfällen eine Abkehr von neoliberaler Stadtpolitik erfordert. Dies ist insofern neu als Veränderungen kommunaler Selbstverwaltung, die über längere Zeit weitgehend unkommentiert abliefen, nunmehr jene auf den Plan rufen, die bislang selbstverständlich davon ausgehen konnten, dass ihnen doch wohl die Stadt gehört. Eben das hat auch ein „Gschmäckle", wie in Bezug auf die undurchsichtigen Aktivitäten Wulffs ja kommentiert wurde, dessen Nuancen nachzugehen sich lohnen würde. Unter Umständen sähe nach einer solchen Degustation auch die Problematik des Stadtgrüns und der Regierung durch Kriminalisierung etwas uneindeutiger aus. Das Einfordern „umfassenderer Konzepte", die uns aus der Misere zunehmender städtischer Disparitäten führen sollten, ist womöglich weniger vielversprechend als das Kleinarbeiten und Ausnutzen von Widersprüchlichkeiten. Ruck (Roman Herzogs Ruck-Rede), Regime Change (George W. Bush), yes we can (Obama und Checker Can samstagabends auf KiKa) – Slogans dieser Art zeitigten noch allemal geringere Effekte als dies ihre Rhetorik vermuten lassen würde.
Wie der letzte Beitrag in diesem Themenblock von Rudolf Martens zeigt, scheint es nämlich geradezu zentrales Merkmal neoliberal inspirierter Politik gewesen zu sein, regionale und städtische Disparitäten zunächst zu ignorieren – die zuvor angemerkte A-Räumlichkeit individualisierender Regularien kommt hier wieder ins Spiel - um sie dann zu Lasten der Schwächeren erneut zu prononcieren. Martens zeigt dies am Beispiel der Sozialversicherungen, insbesondere aber an der Armutsberichterstattung, die noch in den 70er und 80er Jahren durch die Raumberichterstattung mit der Raumordnungspolitik verkoppelt war, nun aber als isoliertes Politikfeld begriffen wird. Auf noch gravierendere Weise wird diese Entkoppelung miteinander verflochtener Politikbereiche deutlich an der Trennung der Berichterstattung zur Wirtschaftsentwicklung von der Armutsberichterstattung und deren Nebeneinander auf der Ebene verschiedener Gebietskörperschaften, die zu einer „politischen Immunisierung des wirtschaftspolitischen Diskurses gegenüber der Wahrnehmung der sozialen Kosten des Wirtschaftsmodells Deutschlands" (Martens 2011: 166) führten.
So werden durch die bundesweit einheitlichen Regelsätze von Hilfen zum Lebensunterhalt die regional unterschiedlichen Bedarfsniveaus, insbesondere der großstädtischen Armutsbevölkerung, systematisch klein gerechnet, indem sie an niedrigere Bedarfsniveaus außerhalb von Großstädten angepasst werden. Insbesondere der Fall München macht aber deutlich, wie Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Sozialgesetzgebung, besonderer Merkmale regionaler Wachstumspfade und deren spezifische Möglichkeiten der Krisenanpassung zu einer räumlichen Kumulation von Armutsrisiken und der Herausbildung einer Armutswirtschaft für einen wachsenden Teil der großstädtischen Bevölkerung führen können. Während also einerseits die herausragende Wirtschaftskraft der Großregion München als Aushängeschild einer prosperierenden Hochtechnologieregion in der Vergangenheit gefeiert wurde, konnten andererseits die ebenso räumlich kumulativen Armutsgefährdungen ausgeblendet werden.
Solchermaßen führt die einseitige Raumblindheit der Politik zu systematischen Verzerrungen, denen auf lokaler Ebene nur korrigierende Maßnahmen mit geringer Wirkungskraft entgegengesetzt werden können. In dem Beitrag von Martens zeigt sich also ein weites Feld weitgehend unbearbeiteter geographischer Forschungsfragen, die die Raumwirksamkeit verkoppelter policy-Felder und politischer Institutionengefüge zu untersuchen hätte. Werden solche Wechselwirkungen vernachlässigt, so können Armutsberichte zwar das Funktionieren des Sozialstaates rechtfertigen, paradoxale oder kumulative Raumwirkungen desselben bleiben aber unerkannt. Wiederum: nicht umfassendere Konzepte sondern genaueres Hinschauen ist hier gefragt.
Dem Vergleich und dem Betrachten von Wechselwirkungen ist der letzte Teil des Bandes gewidmet: Disparitäten zwischen Städten. Gekonnt verquickt Christoph Parnreiter im ersten Beitrag dieses Teils Weltsystemtheorie (Immanuel Wallerstein), radikale Theorien ungleicher Entwicklung von Städten (David Harvey, Neil Smith) und Theorieansätze, die die spezifische Kreativität und Innovationskraft von Städten thematisieren (Jane Jacobs, Richard Florida u. a.), zur Klärung der Frage, warum sich manche Städte zu Knotenpunkten der Weltwirtschaft entwickeln konnten andere aber nicht. In den Grundzügen nicht neu ist dabei seine These, dass sich Disparitäten zwischen Städten mit der jeweils spezifischen Position, die diese in globalen Warenketten inne haben, erklären lassen. Die Stoßrichtung dieser These erfährt aber eine Umlenkung, wenn sie nicht unspezifisch auf Regionen, Nationen oder Unternehmen angewendet wird, sondern auf Städte. Angesichts nicht nur zunehmender Disparitäten zwischen Staaten, sondern auch innerhalb von Staaten, und der Tatsache, dass das Zentrum der Weltwirtschaft durch nicht mehr als etwa ein Dutzend Städte gebildet wird, wie Parnreiter anführt (Parnreiter 2011: 191), ist diese Spezifizierung aber besonders relevant.
Städte seien im Gegensatz zu Wallersteins Weltsystemtheorie eben nicht irgendwelche Gebiete, sondern monopolistisch abgesicherte, nicht territorialisierte Knotenpunkte. Sie seien dies aufgrund ihrer Fähigkeit einer immensen Zentralisierung von Ressourcen als Folge von räumlich selektiven Investitionen (spatial fix). Als solche seien sie eingebettet in polarisierte Städtenetze. Brüche in diesen Prozessen kumulativer Verursachung gäbe es nach Harvey aufgrund der konkurrentiellen Entwertung räumlich fixierten Kapitals. Gegen diese polarisationstheoretische Lesart von Stadtentwicklung führt Parnreiter nun Jane Jacobs an, die die ökonomische Eigendynamik von Städten aufgrund ihrer Bevölkerungsdichte und den Möglichkeiten und Varianten interner Differenzierung hervorhebt. Dabei ist nicht die absolute Größe einer Stadt, sondern ihre Dynamik dafür entscheidend, dass der kumulative Wachstumsprozess sozusagen aus sich selbst heraus erfolgt und nicht durch äußere Impulse gesetzt wird. Infolgedessen entwickelt eine Stadt zunächst eine Exportbasis, um hernach auch Importe durch eigene Produktion zu ersetzen. Diese Fähigkeit zu dynamischer Entwicklung erwächst aber aus der Herausforderung, Lösungen für die Probleme städtischen Wachstums zu entwickeln, mithin in der Bearbeitung von Agglomerationsnachteilen. Wo also Gefahr ist, wächst das Rettende auch, wie schon Hölderlin wusste. Damit es nicht ganz so einfach ist, schränkt nun der world city-Forscher Peter Taylor Jacobs' These insoweit ein, dass die 'Rettung' auch Neues hervorbringen müsste, damit eine Monopolrente abgeschöpft werden könne. Insgesamt laufen diese Ausführungen auf eine Integration der Global City- und der Global Commodity Chain-Forschung hinaus.
Nun kommt aber der eigentlich interessante Punkt Parnreiters, dass nämlich zur Klärung der Frage, warum sich manche Städte in zentralen Positionen von Warenketten finden, andere hingegen nicht, eine historisch vergleichende Untersuchung angestellt werden müsse. Das Bild und somit auch die theoretische Herausforderung komplizieren sich dann insofern, als weniger direkte Kausalitäten im ökonomischen Sinne als „konvergente Verursachungen" zu finden wären, die sich in ihrer Wirkung auf die Polarisierung zwischen Städten gegenseitig verstärken, abschwächen oder aber disparat zeigen könnten, so Parnreiter.
Wenn also Weltsystemtheorie, Polarisationstheorien à la Harvey und Smith und Jacobs' Variante endogener städtischer Entwicklung nur von Fall zu Fall und im möglichen Widerspruch zueinander eine gewisse Erklärungskraft besitzen, drängt sich der Verdacht auf, dass hier zu viel mit zu wenig erklärt werden soll. Die Krux historisch vergleichender Forschung ist nämlich nicht nur, dass hier ein komplexeres Verständnis von Kausalität zugrunde gelegt wird, sondern auch, dass die Fragestellung einer vergleichenden Untersuchung im Zusammenhang mit der Fallbeschreibung präzisiert werden muss. Eben dies fehlt aber in dem Potpourri an Theorien, den Parnreiter auftischt. Und schließlich könnte ein Blick in die Historie zeigen, dass Weltstädte und Städtenetze doch nicht so ganz unabhängig von der territorialisierenden Logik von Staaten bzw. Staatenbünden reüssieren, wie Parnreiter anzunehmen scheint. Diese Wechselwirkung nicht in Betracht zu ziehen, bringt Parnreiters Argumentation in die Nähe einer ökonomistisch verengten Perspektive, die Städte als alleinige Wachstumsmotoren betrachtet und die verzweigten Stadt-Umland-Beziehungen vernachlässigt. Und schließlich leben auch die Menschen ländlicher Regionen nicht völlig hinterm Mond. Diesbezüglich wäre eine Auseinandersetzung mit Lefèbvre's Argument der Verstädterung wünschenswert (vgl. Lefèbvre 1990).
Den Fokus auf die Interaktion nationalstaatlicher Politiken mit städtischer Politik legt dagegen Andrej Holm in seiner vergleichenden Analyse von Privatisierungen öffentlicher Wohnungsbestände in London, Berlin und Amsterdam. Er geht dabei der Frage nach, warum trotz ähnlichen Ausmaßes deutliche Unterschiede zwischen diesen Privatiserungsanstrengungen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die lokalen Wohnungsversorgungssysteme und die sozialräumlichen Disparitäten innerhalb dieser Städte festzustellen sind. Obwohl es sich hierbei um nationale Politiken handelt, vertritt Holm die These, dass den kommunalpolitischen Steuerungsinstrumenten eine entscheidende Bedeutung bei der räumlichen Struktur der Privatisierungen und den Rahmenbedingungen zur Abschwächung sozialer Polarisierungen zukommt. Diese These steht in einem gewissen Gegensatz zur These von Müller/Sträter in diesem Band von der Aushebelung kommunaler Selbstverwaltung.
Beispielhaft sei hier aber der Fall London skizziert. Es war erklärtes Ziel der Thatcher-Regierung, die Macht der Labour Party in den Kommunen zu brechen und hierzu deren strategisch wichtigen Zugriff auf die Wohnungspolitik zu unterbinden, indem vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser aus kommunalem Besitz an die Bewohner und zusammenhängende Wohnanlagen an Wohnungsgesellschaften (housing associations) verkauft wurden. Die Finanzierung von Sozialwohnungen konnte damit an den Kapitalmarkt angebunden werden. Jedoch gelang dies in London erst mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa 10 Jahren in den Jahren 2001-2005. Allerdings scheint mir das Gesetz zum Verkauf kommunalen Wohnungsbestandes an Wohnungsgesellschaften von 1988, mit dem Holm diesen verspäteten Privatisierungsboom in der Hauptstadt erklärt, nicht hinreichend als Ursache für diese Verspätung. Gerade im Rückblick der Finanzkrise dürfte die beginnende Entwicklung einer Immobilienblase am Kapitalmarkt doch eine entscheidende Bedingung gewesen sein, wiewohl hierfür das genannte Gesetz von 1988 eine Grundvoraussetzung war. Die Schwächung kommunaler Selbstverwaltung war demnach nicht unbedingt ausschlaggebend, wohl aber der in Holms Argumentation vernachlässigte Finanzmarkt. Wenn das Ziel neoliberaler Politik die Marktgängigkeit und Kapitalmarktfinanzierung kommunalen Wohnungsbaus ist, so weist dies London als äußerst erfolgreichen Fall aus. Im Ergebnis habe es zur Entstehung von hochsegregierten sozialen Problemgebieten in den Residualbeständen öffentlichen Wohnungsbaus geführt, und zu einem Anstieg von Obdachlosigkeit aufgrund von Schwierigkeiten, Immobilienkredite zu bedienen.
Im Gegensatz dazu basieren Wohnungsprivatisierungen in Deutschland wesentlich auf kommunalpolitischen Entscheidungen, die im Hinblick auf die Konsolidierung kommunaler Finanzen getroffen wurden, auch wenn dieser Effekt wohl eher als gering zu veranschlagen ist. Entsprechend wurde den Bewohnern kein Vorkaufsrecht eingeräumt. Stattdessen wurden 60% der Berliner Wohnungen in kommunalem Besitz en bloc an internationale Finanzinvestoren verkauft und damit direkt dem Kapitalmarkt zugeführt. Im Gegensatz zu London, wo das untere Segment des Wohnungsmarktes in öffentlicher Hand verblieb, wurde in Berlin gerade dieses Segment den internationalen Wohnungsgesellschaften und damit einem substanzverzehrenden Geschäftsmodell zugeführt, dessen Mietpreis sich auf dem Niveau der Hartz IV-Bemessungsgrenze bewegt. Lediglich in attraktiven Innenstadgebieten verfolgen diese Gesellschaften eine Aufwertungsstrategie. Die sozialräumlichen Effekte scheinen sich hier weniger in zunehmender Segregation als in einer mittelfristigen Verwahrlosung des niedrigpreisigen Wohnungsbestandes zu zeigen.
Auch in Amsterdam weisen die preiswerten Wohnungen in weniger begehrten Gebieten die höchsten Verkaufsquoten auf. Allerdings können hier die Bewohner als Käufer auftreten. Dies liegt unter anderem daran, dass in attraktiven Wohnlagen eine äußerst schleppende Privatisierung stattfindet, da die monatlichen Hypothekenzahlungen die Mietpreise um ein Vielfaches übersteigen würden. Obwohl vor allem Bezieher mittlerer Einkommen, kinderreiche Haushalte, ethnische Minderheiten und lokale Anwohner von dieser Politik profitieren, besteht auch hier die Gefahr einer Entmischung der Bewohnerschaft von Sozialwohnungen und damit deren Stigmatisierung. So konnte sich eine für die Niederlande neue Wohneigentumsideologie durchsetzen, während die Abhängigkeit der für den sozialen Wohnungsbau verantwortlichen Wohnungsbauvereinigungen von der Zentralregierung, die bislang Ausdruck des öffentlichen Interesses am Mietwohnungsbau war, aufgelöst wurde. Diese Entflechtung erfolgte auf der kommunalen Ebene durch Vereinbarungen zwischen den Stadtverwaltungen, den Wohnungsbaugesellschaften und Mieterorganisationen. In Amsterdam führte diese Politik lediglich zu einer Zunahme der Eigentumsquote um 4% (Holm 2011: 225).
Obwohl Holm in den untersuchten Großstädten ja den Einfluss der Kommunen auf das Privatisierungsgeschehen am Wohnungsmarkt als entscheidend erachtet, bleibt das Argument doch gut hinter dem Detailreichtum und der Komplexität der Materie versteckt. So unterbleibt nicht nur ein systematisierender Blick auf die Besonderheiten genau dieser Großstädte im Verhältnis zu nationalstaatlicher Politik, sondern auch auf die Verallgemeinerbarkeit dieses Argumentes auf andere großstädtische Kommunen dieser Länder. Im Sinne von Parnreiter wäre hier anzuführen, dass es sich bei London, Berlin und Amsterdam ja nicht um irgendwelche Kommunen handelt, sondern um globale Zentren. Des weiteren weisen zwar die Politiken der Wohnungsprivatisierung unterschiedliche Hintergründe und Akteure auf, die Boomphase der Privatisierung von 2001–2005 ist aber über alle drei Fälle hinweg gleich. Die Frage ist daher legitim, ob nicht der Kapitalmarkt einen größeren Einfluss auf die Privatisierungsdynamik gehabt haben könnte als kommunalpolitische Steuerungsinstrumente.
Der letzte Artikel dieses Bandes widmet sich einem anderen Aspekt der Segregationsproblematik. Carsten Keller wirft die Frage auf, inwiefern Segregation als ursächlich für die Entstehung der Unruhen in verschiedenen Städten Europas im vergangenen Jahrzehnt betrachtet werden könne. Dabei sieht Keller in dem Verhältnis von Segregation und Ausgrenzung einen Schlüsselaspekt zur Klärung dieser Frage. Grundlage dieser Argumentation ist ein schwacher Ghettobegriff, der in der Lage ist, die verschiedenen Erscheinungsformen und internen Differenzierungen von Ghettos zu fassen, ohne den Begriff als solches verwerfen zu müssen. Dabei weist Keller, die vor allem von Wacquant vertretene These, dass ethnische Segregation konstituierend für die amerikanischen Ghettos und eine sozioökonomische kennzeichnend für die französischen Banlieues sei, zurück. Vielmehr überlagerten sich in beiden Fällen ethnische und soziale Ausgrenzung. Während aber in den USA die räumliche Ausgrenzung nach ethnischen Kriterien im Abnehmen begriffen sei, hätten gerade die Unruhen in den Banlieues von 2005 die ethnische Dimension auch der französischen Ghettos in den Blick gerückt.
Keller führt hierbei vor, wie schwierig die statistische Erfassung dieser Kriterien ethnischer und sozio-ökonomischer Ausgrenzung mithilfe von Dissimilaritätsindizes, Indizes der Interaktion und Isolation sowie der prozentualen Anteile von ethnischen Minderheiten und Arbeitslosen in bestimmten Vierteln zu beurteilen ist. So wichtig eine solche Analyse für die differenzierte Beschreibung von Ghettos auch sein mag, so liefert sie aber doch einer behavioralistischen Erklärung städtischer Unruhen Vorschub, die letztlich auch von Keller nicht völlig ausgeräumt wird. Für ihn scheint die Diagnose klar, dass „das Zusammentreffen ethnischer und sozialer Ausgrenzungen im Raum eine Grundkonstellation für die Unruhen ist" (Keller 2011: 241). Eine stärker soziologische Untersuchung, die auch den Erfahrungsraum und weniger die rein statistische Merkmalsverteilung dieser Viertel berücksichtigt, kann indessen die äußerst relative Mischung von Quartierseffekten und Lageeffekten zeigen (Kronauer/Vogel 2001, Klagge 2005). Ethnische und soziale Ausgrenzung „im Raum" können daher höchst unterschiedliche Auswirkungen haben.
Dieser stärker erfahrungsorientierte, eher phänomenologische Blickwinkel auf den Raum wird jedoch von Keller nicht gesucht. Stattdessen bringt er politische und historische Gründe zur Erklärung städtischer Unruhen an. Der starke koloniale Hintergrund, der als Mobilisierungsfolie dienen kann, überhaupt das Verhältnis des Staates gegenüber Minderheiten, das kollektiv gespeicherte Gefühl der Unterdrückung, die räumlichen Politiken der Sicherheit und Überwachung in einem Kontext wachsender Xenophobie – das ist die Gemengelage aus der nach Keller städtische Unruhen entstehen, die folglich als staatlich überformte Konflikte zwischen Mehrheiten und Minderheiten zu verstehen seien.
Nach Keller taugt dies durchaus als Erklärung der städtischen Unruhen in Frankreich, Großbritannien und den USA. Demgegenüber böten Länder ohne koloniale Vergangenheit wie Deutschland, Griechenland und Italien keine Möglichkeit historische Machtasymmetrien zu re-aktualisieren, hätten keine post-koloniale Immigration vorzuweisen und ihre Städte seien weniger segregiert. Vor diesem Hintergrund führe das Zusammentreffen ethnischer und sozialer Ausgrenzung im städtischen Raum zu „Respektabilitätskämpfen", in denen Ausländern die unterste Stufe zugewiesen wird, während Gewalt von der deutschen Mehrheit ausgeht. (Ja, wo hatten wir das denn schon einmal? Aber Deutschland hat ja keine koloniale Vergangenheit ..., vgl. z.B. Conrad/Osterhammel 2004). Daher diagnostiziert Keller einen Minderheitenkonflikt von oben. Dieser könne aber, wie im Falle Italiens, in einen Minderheitenkonflikt von unten umschlagen, wenn sich Sicherheits-, Migrations- und Sozialpolitik auf repressive Weise verdichteten. Am wenigsten träfe diese Diagnose für Griechenland zu, wo weniger ethnische als kulturell-politische Diskriminierung für die Unruhen verantwortlich zu machen seien. Zusammenfassend kommt Keller zu dem Schluss, dass „sich im zeitlichen Verlauf eine Abschwächung der Bedeutung städtischer Segregation feststellen lässt, die zwar eine Bedingung bleibt, deren Ausmaß jedoch stark variieren kann" (Keller 2011: 246).
Nun ist aber doch auffällig wie sich im Ländervergleich die räumliche Dimension, zu deren Relevanz vorher soviel statistisches Beweismaterial heran geschafft worden war, zugunsten politischer und historischer Erklärungen aufgelöst hat. Am Ende spielt die Segregation wohl doch nicht so eine große Rolle. So sehen ethnische und soziale Ausgrenzung „im Raum" aus, also die Häufung bestimmter sozialer Merkmale im (Container)Raum, wenn der Raum als erklärende Variable im Sinne einer Erfahrungswelt keine Rolle spielt. Dabei ist es gerade diese alltagsweltliche Diskriminierung, die stärker noch als institutionelle Benachteiligung den Boden rassistischer und sozialer Ausgrenzung bildet (vgl. Lewis 2012). Rassismus, Dünkel und Vorurteile gegenüber Andersdenkenden stehen vielleicht doch in einem komplexeren Zusammenhang mit institutionellen Strukturen und Raumerleben als dies statistische Verteilungen sozialer Merkmale und Kontaktchancen zwischen „Menscheneinheiten" erfassen könnten.
Grenzgang
Dies ist der Moment, um sich Hasses phänomenologischem Text zuzuwenden. Im Gegensatz zu Belina et al. ist sein Rundgang entlang den verdeckten Rändern der Gesellschaft nicht Selbstzweck, sondern strategisches Mittel der Entfremdung. Entgegen poststrukturalistischer und postkolonialer Denke, wo zwar „das Andere" anerkannt, aber in seinem konstituierenden Verhältnis zum Eigenen dargestellt und damit eben nicht dem exotisierenden Blick zur Schau gestellt wird, beabsichtigt Hasses Exotisierung des GeWohnten eine „Arbeit des Wohnens" in Gang zu setzen, um das „Prinzip der Schonung" als „bewusste Vernetzung orts- wie raumbezogener Lebenstätigkeiten" (Hasse 2009: 33) als sorgend bedachte Haltung zu etablieren. Wie sehr diese Haltung in Vergessenheit geraten ist, offenbart schon die flüchtige Erinnerung an das, was noch von unserer Großelterngeneration „schonend" bewahrt wurde: die „gute Stube", Sonntagskleider, „gutes Geschirr" und was nur zu besonderen Anlässen zum Bestaunen hervorgeholt werden durfte. Haben wir also mit der schonenden Haltung auch die Gelegenheit zum Staunen verloren? Ist es nicht vielmehr so, dass uns das Geschonte nur noch in Staunen versetzen kann, wenn es uns bereits als Neues im Alten entgegentritt, als Retrospektive also, die in ihrer ursprünglichen Gegenwart keinerlei Besonderheit ausstrahlte? Wer, wie Heidegger, auf den Grund eigentlichen Seyns blicken will, kann sich mit solcherlei übrig gebliebenem Gerümpel kaum zufrieden geben. Eher noch spannt hier Walter Benjamins Angelus Novus vor den Trümmern der Geschichte erschrocken seine Flügel auf (vgl. Benjamin 1966).
Nun ist Hasse aber nicht an einer nostalgischen Rückbesinnung auf hohl gewordene Gebrauchstabus gelegen. Vielmehr geht es ihm um die Möglichkeit, das Leben wohnend zu gestalten, d. h. in der chaotischen Mannigfaltigkeit einer sich darbietenden Wohnsituation eine spezifische Sichtweise auf Sachverhalte, Probleme und Programme des persönlichen und gemeinsamen Wohnens zu entfalten. An dieser Möglichkeit entscheide sich, ob das Leben geführt werden kann oder nur mehr auszuhalten ist. Das Prinzip der Schonung ist also nicht als passives Decorum zu verstehen, sondern es fordert unser Denken und unsere alltägliche Lebensführung heraus.
Bereits an Hasses Darstellung des grenzwertigen Wohnens im Gefängnis wird deutlich, dass sich diese Lebensführung nicht nur in den „eigenen vier Wänden" entfaltet, und sich in Praktiken des Wohnlichmachens erschöpft, sondern mittels Visionen und Horizonten des Wohnens deutlich über diese hinausgreift. Wenn Hasse nun als ausführlicheren Generalfall das Wohnen im Gefängnis untersucht, so verknüpft er dies mit der Frage, inwieweit Selbstbestimmung im Wohnen überhaupt möglich ist. Hierfür liefert das Gefängnis den nach innen und außen maßgeblich gesellschaftlich determinierten Testfall, denn an ihm werden in besonderer Weise die Ritualisierung und Disziplinierung, die körperliche Empfindung, die Perspektivität und die Symbolträchtigkeit des Wohnens deutlich.
Der historische Rückblick auf Gefängnisse als Orte räumlicher Isolierung in Anlehnung an Foucault führt Hasse schließlich zu der These, dass „die Menschen sog. postindustrieller Gesellschaften in diesem Kerkersystem wohnen" (Hasse 2009: 70), das alle disziplinierenden Diskurse einer Gesellschaft einbezieht und sich durchaus nicht auf das Gefängnis beschränkt. Dieses so verstandene Wohnen unter Extrembedingungen liefert den Hintergrund vor dem sich minimale Ausdrucksformen des Wohnens abbilden lassen als a) Territorialisierungen, b) Konstitutierung ritualisierter Ordnungsstrukturen, c) Aneignung des Wohnraums und der Wohnumgebung, d) der Herstellung sozialer Beziehungen, e) der Bildung einer Subsprache und f) der Differenz des Wohnens zum Wandern (vgl. Hasse 2009: 69). Dabei beansprucht gelingendes Wohnen „einen Raum, aus dessen herumwirklicher Atmosphäre sich die eigene Lebenssituation in eine individuell und/oder gemeinsam lebbare Zukunft empfinden und denken lässt" (Hasse 2009: 43). Dies verlange nach Heidegger eine „denkende Praxis der Schonung", die sich als größtmögliche Freiheit des (Be)Wohnens von einem nur verortenden Leben absetzt. Das „Wohnen im Kerkersystem" der Gesellschaft läuft nun aber Gefahr, gerade auf dieses Niveau herabzusinken.
In aufsteigender Reihenfolge eines scheinbar zunehmend gelingenden Wohnens, immer an jenen „verdeckten Rändern der Gesellschaft" entlang hangelnd, stellt Hasse nun in Einzelberichten die Wohnverhältnisse von Obdachlosen, Mönchen, Seeleuten, Senioren in Heimen, alten Menschen im Sozialwohnungsbau, von sogenannten Young Urban Professionals, Wagenburgbewohnern und schließlich, noch weiter in diese Richtung treibend, Kreativarbeitern vor. Eingeordnet werden die einzelnen Wohnsituationen jeweils durch kontextualisierende Zwischenkapitel und Retrospektiven, in denen sich die interpretierenden Fallgeschichten auf einer allgemeineren Ebene verdichten und zu den theoretischen Überlegungen in Resonanz gebracht werden.
Während das Gefängnis aufgrund äußerer Bedingungen das Wohnen-Können erschwere, stellt das Wohnen Obdachloser einen Fall unterbrochenen Wohnen-Könnens auf der persönlichen Ebene dar. Dabei beginnt die Zersetzung des Wohnens in seinem schonenden Charakter bereits mit dem Auflösen der sozialen Netze des Lebens und kulminiert in gravierenden Beschädigungen am eigenen Leib, die einem künftigen Wohnen-Wollen entgegenstehen (Hasse 2009: 92). Dennoch kann auch die Lebenssituation Obdachloser ein Bedenken des Wohnens aufnötigen, sofern das erhoffte Wohnen in einer Wohnung als Horizont erhalten bleibt. Allerdings rücken die von Belina thematisierten Betretungsverbote als raumbezogene Diskriminierungen diesen Horizont wohl in
noch weitere Ferne.
Die innere Disposition zu einer bestimmten Weise des Wohnens spielt auch beim klösterlichen Wohnen eine tragende Rolle. Während vordergründig das orts- und zeitlose, auf ein Jenseitiges gerichtete Wohnen der Mönche an Obdachlosigkeit erinnern mag, so ist doch die Abschirmung gegenüber äußeren Einflüssen Garant dafür, dass eine heilige Atmosphäre wohnenden Geborgenseins ein „Dach über ihrer Seele" ausbreiten kann (Hasse 2009: 110). In diesem Sinne ist das bedachte Wohnen essentiell für das persönliche religiöse Erleben des Einzelnen als auch für dessen selbst auferlegten Auftrag, in der Gesellschaft zu wirken.
Eine zusätzliche Infragestellung sesshaften Wohnens ergibt sich aus der Lebenssituation von Seeleuten, vor allem wenn sie nach einem Leben auf See in Seemannsheimen eine letzte Zuflucht finden. Ihre beruflich erzwungene soziale Bindungslosigkeit, hierin vergleichbar mit derjenigen vielreisender professionals, findet seinen Ausdruck schließlich in einem Proto- oder Semi-Wohnen, das als heimatloses Leben „nun gleichsam auf der Stelle tritt" (Hasse 2009: 123). In dieser Situation äußert sich die Not des Wohnens in der Herausforderung, das Wohnen nach der Periode der 'Wanderschaft auf See' erst wieder lernen zu müssen. Obwohl also auch hier das Wohnen durchaus bedacht wird, führt die Entwurzelung ihres Lebens und die Auflösung eines gemeinschaftlichen Erlebens zu einem „allein noch funktionalistischen Aufenthalt in Räumen, deren Atmosphäre sich in einem Vakuum des Dazwischen langsam auflöst" (Hasse 2009: 126). In ähnlicher Weise wird das selbstbestimmte Wohnen von Senioren in Altersheimen als bedroht empfunden, wenn, wie Hasse es ausdrückt, Wohnen nicht mehr Ausdruck des Lebens, sondern das Leben nur mehr Ausdruck des Wohnens ist. Dieses Wohnen im Alter sei gefangen in einer administrativen, juristischen und aseptischen Rationalität fakturierbarer Dienstleistungen. Hasse spricht hier sogar von einem „menschenunwürdigen Akt der Gewaltausübung gegen vitale Bedürfnisse der Selbstbehauptung", wenn selbstbestimmtes Wohnen überhaupt nicht mehr möglich ist (Hasse 2009: 147).
Während in den bisherigen Kapiteln die Fragwürdigkeit der Wohnsituation mehr oder weniger offenkundig war, bezeichnet der Bericht über das Wohnen älterer Menschen im Sozialen Wohnungsbau einen Umschlagspunkt, von wo sich das unter Leidensdruck bedachte Wohnen in ein fraglos gegebenes Wohnen wendet, um in den folgenden Kapiteln zu bewusst gestaltetem Wohnen aufzusteigen. Dieses Wohnen, gleichsam am Nullpunkt der Wohnarbeit angesiedelt, ist Ausdruck eines Wohnmodells, das noch in den 60er Jahren für die breite Masse konzipiert war, nun aber, nicht zuletzt durch die Privatisierungen, die ja das Thema Holms in dem Band von Belina et al. sind, vielfältigen Wandlungen unterworfen ist und in seinem ursprünglichen Verständnis als obsolet betrachtet wird. Dadurch ist den von Hasse besuchten alten Menschen, die „so hier wohnen geblieben" sind (Hasse 2009: 147), ein zukunftsgerichteter Horizont des Wohnens abhanden gekommen. Über die Jahre hat man sich mit den gegebenen Bedingungen arrangiert, sich in dem Gefühl des „Gut"-Wohnen-Könnens eingerichtet, ohne dass die aktuelle Situation noch des Bedenkens wert wäre. Die für gelingendes Wohnen unablässige Wohnarbeit ist erlahmt, läuft in der Bewahrung des Eingerichteten ins Leere. Im Extrem zeigt dies der Fall einer Frau, den Hasse beschreibt, die sich nach dem Tod ihres Mannes in ihrer Wohnung, ja in ihrem Leben, „auswohnt": „Frau S. wohnt mehr im leiblichen Stimmungsraum ihrer Erinnerungswelt als in einem physischen und atmosphärischen Wohnraum, der ihr doch auch in der Gegenwart für das eigene Leben Spielräume gewähren könnte" (Hasse 2009: 158).
In mehrfacher Hinsicht ist das „Wohnen auf der Belle Etage", das Hasse als erstes Beispiel gelingenden Wohnens anführt, spiegelbildlich hierzu organisiert. Zum einen handelt es sich genau um jene luxussanierten Eigentumswohnungen, die aus vormals vermieteten preiswerteren Wohnungen hervorgegangen sind, oder um neue postmoderne Architekturen an revitalisierten Randlagen, denen in der Regel Verdrängungsprozesse weniger wohlhabender Bevölkerungen vorangegangen sind. Zum anderen greift das Wohnen und die damit verbundene Wohnarbeit weit über die eigenen vier Wände hinaus, und schließlich gelingt es den Bewohner/inne/n eine individuell gestimmte Wohnatmosphäre zu schaffen, die das leibliche Erleben einbegreift und solchermaßen auch das Denken orientieren kann. Auch unabhängig davon, dass es sich hierbei um eine Lage am oberen Rand der Gesellschaft handelt, sind es diese letzten beiden Merkmale, die erst milieubildend wirken und darin einen durch symbolische und habituelle Differenzen strukturierten öffentlichen Raum mit äußerst ungleichen Zugangsbedingungen konstituieren.
Mit dieser Szenerie bewegen wir uns zwar am oberen Rand, aber dennoch in der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft, insofern als sie eine „Integrationsfassade" (vgl. Honneth 1999) vorspiegelt, die, das Wohnmodell des 60er Jahre Sozialwohnungsbaus überlagernd und verdrängend, als anstrebenswertes Muster dem Normalbürger angedient wird, „Schöner Wohnen" eben. Wie Hasse ganz treffend bemerkt, sind dies „performative Prozessfelder einer sich allmählich abzeichnenden neuen Ordnung der Gesellschaft" (Hasse 2009: 181). Was bei Brake etwas klischeehaft klingen mochte, jedoch in einen sozioökonomischen Zusammenhang gestellt war, erscheint hier in seinem phänomenologischen Ausdruck. Aber auch unter diesem Blickwinkel kann Hasse auf dem Hintergrund der Globalisierung eine „zunehmende Schärfe im Bild der sich neu- wie umgestaltenden Viertel" konstatieren (Hasse 2009: 181).
Gegen die gesellschaftliche Ausstrahlungskraft dieser Wohnsituation richtet sich das Wohnen in Wagenburgen, das Hasse als erstes von zwei Modellen alternativen Wohnens darstellt. Während sich das Milieu der Belle Etage aus der gegebenen Ordnung der Gesellschaft speist, in die sich die Einzelnen 'zwanglos' einfügen, erfordert das Leben in der Wagenburg eine immer wieder auszutarierende Orientierung zwischen individuellen Lebenszielen und dem in ökologischer wie sozialer Hinsicht als alternativ erstandenen Wertesystem der Wagenburggemeinschaft. Aber während sich Szeneviertel in „familientaugliche rauchfreie Dinkelkieze" gewandelt haben, sind Wagenburgen als experimentellste alternative Wohnform auf städtische Zwischenräume abgedrängt und staatlicher Repression ausgesetzt, die in Ignoranz dieser Wohnform Wagenburgbewohner vertreibt und damit erst obdachlos macht. Zu offensichtliches Anderswohnen wirkt störend und beängstigend: "... so wandelt sich die Furcht im situativen Erleben doch in eine gleichsam von überall einströmende Macht, die den Wesensbestand sicher geglaubten Lebens ins Wanken bringt" (Hasse 2009: 198). Nunmehr in eine genügend fragwürdig fragende Position gebracht, fragt sich der Leser jetzt schon, wer hier eigentlich wen „stört". Offenbar führen sowohl die Proklamationen der Wagenburgbewohner als auch die Verdächtigungen der Anwohner sich wechselseitig verstärkend zu einer ausufernden Wohnarbeit der Abgrenzung. Wie war das noch gleich mit Marit Rosols Arbeit über Gemeinschaftsgärten, die tendenziell selbst exkludierend wirken?
Abschließend berichtet Hasse über eine offenere Form alternativen Wohnens, einmal am Beispiel der Wohnung eines Designers in einem ehemaligen Fabrikgebäude und dann einer Frankfurter Groß-WG von 30 Personen, die Hasse unter dem Begriff Post-Kommune abhandelt. In gewisser Weise könnte man auch von der Klientel der letztgenannten Wohnform sagen: „Und so sind wir einfach hier wohnen geblieben", wie die älteren Paare im Sozialen Wohnungsbau, da es sich in der Regel um im Berufsleben angekommene, zum Zeitpunkt der Projektgründung studierende Bewohner handelt. Im Unterschied zum Sozialen Wohnungsbau wird hier aber politisches Engagement und die Beteiligung an Wohn- und Stadtteilprojekten vorausgesetzt, also ein politischer Wille zu kreativer Problemlösung. Obwohl die Postkommune die einzige von Hasse dargestellte Wohnform ist, in der die Bewohner eine bewusst bedachte kollektive Wohnarbeit auch äußern, steht sie doch „eher in der Gefahr stigmatisierender Zuschreibungen, als dass (sie) in der Wahrnehmung der bürgerlichen Öffentlichkeit als Hort neuer für die Gesellschaft im Allgemeinen fruchtbarer Ideen des Lebens und Wohnens aufgefasst würde" (Hasse 2009: 216). An die Stelle revolutionärer Programmatik á la K2 sei nun eine postkritische Haltung getreten, die in dieser Wohnform eher einen Ausdruck je besonderen Lebens findet, das sich in den Raumzuschnitten bürgerlichen Wohnens eben nicht verwirklichen lässt. Dies ist nur mit einem gerüttelten Maß kreativer Neuaneignung bestehenden Wohnraums möglich, der für eine „'wohnbare' soziale Utopie des Miteinander" (Hasse 2009: 219) zugerichtet werden muss.
In gewisser Hinsicht schließt sich hier der Rundgang durch die Randbezirke des Wohnens, wenn das fremdbestimmte Wohnen im Gefängnis über die Kapillaren des gesellschaftlichen „Kerkersystems" im Sinne von Foucault mit den Inseln kollektiver Wohnformen kurzgeschlossen wird. In einem kreativen détournement gelingt es zumindest ansatzweise, den Wohnraum als Angelpunkt gesellschaftlicher Veränderung so umzugestalten, dass hieraus auch selbstbestimmte Lebensformen erwachsen können. Von den minimalbedingungen des Wohnens windet sich Hasses Untersuchung zu einem scheinbaren Ideal maximaler Wohnarbeit hinauf, die in ihrer Schaffung selbstbestimmter Atmosphären doch nicht über ihre je eigene Wohnsituation hinausreichen kann.
Trotz der Normalität des Wohnens, seiner Ubiquität, um nicht zu sagen seiner Banalität, fungiert das Wohnen doch auch an jeder Stelle als Instrument der Abgrenzung, durch die ein Schutz- und Schonraum individuellen Lebens eingerichtet wird. Wir sind sozusagen in unseren Wohnhülsen in die Welt hinein gehalten, und in diesen vordiskursiven, haptisch-atmosphärischen Arrangements fordert uns Hasse mit Heidegger auf, einen reflektierten, gerade schon bedachten Übergang nach draußen zu suchen. Dies könnte ein eminent politischer Moment sein, eine Differenz zwischen Politik und dem Politischen im postfundamentalistischen Sinne (vgl. Marchart 2010), bei deren Überschreiten der Diskurs anspringt. Im wahrsten Sinne des Wortes markierte die Türschwelle jenen Übertritt, durch den die Welt in unsere Behausungen einsickert und zugleich die Verletzlichkeit wohnenden Lebens offenbar wird. Allerdings geht Hasse diesen Schritt nicht, wiewohl Heidegger ja auch für postfundamentalistische Argumentationen die theoretische Vorlage liefert (vgl. ebd. insbes. S. 18 - 22).
Obwohl Hasse am Ende darstellt, wie sehr gerade randständige Wohnweisen als systemische Antworten auf strukturelle Krisen heterotope Räume kreieren, bleiben diese doch als Illusions- bzw. Kompensationsheterotopien (vgl. Hasse 2009: 238) im Vorpolitischen stecken. Sollte diese ganze Wohnarbeit dann doch nur zur illusionären oder kompensatorischen Aufrechterhaltung eines mythisch verklärten Schonraums taugen, ohne dass die Grenze zu einer Wirklichkeit, wie sie z. B. von Belina et al. beschrieben wurde, jemals durchbrochen werden könnte? Ohne dass man jetzt die ganze Wagenladung des Kritischen Realismus (vgl. Sayer 1985, Jessop 2002 ) auffahren müsste, wäre dies als eine Wirklichkeit zu verstehen, die nicht nur in ihren Bedeutungssträngen befragbar, sondern durchaus auch im Handgemenge kontingenter Strukturen auf antagonistische Weise verstanden und verändert wird. Schließlich sollte der Realitätssinn, der sich erst im Überschreiten verengender Blickwinkel herausbildet (vgl. Curtis 1999), auch im Wohnen nicht vollständig flöten gehen. Doch hier dräut eine Diskussion zwischen Foucaultianern, Linksheideggerianern und Neuen Phänomenologen, die ich gerne den Philosophen überlasse.Am Ende nimmt Hasse seine Aufforderung, das Wohnen doch zu bedenken, ohne Not wieder zurück, indem er die mythische Macht hervorhebt, mit der auch und gerade Formen normalen Wohnens sich gegen „'kreative Infektionen' durch anderes Wohnen" (Hasse 2009: 239) abdichten. Zwar dokumentieren die heterotopischen Randformen des Wohnens ein punktuelles Scheitern gesellschaftlichen Funktionierens und provozieren Fragen danach, wie wir denn wohnen wollen, produzieren mithin also „große Denkwürdigkeit i. S. Heideggers" (Hasse 2009: 239). Wenn wir aber mehr wollen als Maulaffen feil halten und besagte postkritische Haltung nicht nur im eigenen Alternativglück zelebrieren wollen, müssten wir dann nicht über philosophisches Staunen hinaus um Handeln übergehen, der Neugründung von Wohnformen, die die Unzufriedenheiten bürgerlicher Kleinfamilien durcharbeitend nicht in neuerlichen Abschottungen münden, sondern genau zu Infektionsherden bedenklichster Verursachungen werden? Richtig bedacht: Wer verrichtet denn in der Regel diese Wohnarbeit? Wird nicht Wohnarbeit zusehends ausgelagert (vgl. Pratt 2004, Devetter/Rousseau 2011)? Wie oft fallen denn WohnarbeiterIn und im Wohnen DenkendeR tatsächlich in ein- und derselben Person zusammen?
Widersprüche dieser Art, in der Perspektive von Belina et al. „Nebenwiderspruch" genannt, tauchen bei Hasse nicht auf, obwohl man ihm nicht vorwerfen kann, er hätte nicht genügend Fälle des Wohnens von Frauen beigebracht. Ist nicht auch der Normalfall familiären, heterosexuell arbeitsteiligen Wohnens mit Widersprüchen gepflastert, deren Elemente uns quer durch alle Bevölkerungsschichten um die Ohren fliegen (vgl. z. B. Beck-Gernsheim 1998)? Wäre es nicht mindestens genauso fragwürdig gewesen, den Schleier der Normalität von diesem Konstrukt zu ziehen, das sich Familie nennt? Aber nein, dieser Schleier ist ja schon längst zerfressen, und ist, trotz unablässiger Restaurationsbemühungen, unwiederbringlich in den Randbezirk gesellschaftlicher Wohnarrangements abgerutscht.
Trotz seiner Schlussdiskussion zum Zusammenhang von Wohnen und Macht vergibt Hasse damit die Chance, den Mythos normalen Wohnens, der ja durchaus auf andere Wohnformen ausstrahlt, so zu demontieren, dass auch er in der Lage wäre, ein anderes Licht auf Randformen des Wohnens zu werfen. Was fällt, muss man aber stoßen, und nicht mythische Stabilisierung als notwendiges Übel heterotoper wie normaler Wohnformen so hinstellen, als wäre sie zur Wahrung einer Grenze der Privatheit unabdingbar. Wenn die untersuchten Wohnformen tatsächlich „systemische Antworten auf strukturelle Krisen" (Hasse 2009: 239) sind, dann folgert daraus noch lange nicht, dass sich Antwort und Krise leichterdings entsprechen. Nichts bringt sich „gleichsam massenhaft als Ausdruck allgemeiner gesellschaftlicher Verhältnisse zum Ausdruck" (Hasse 2009: 239), einfach so. Der Ausdruck, im Zusammenhang allgemeiner gesellschaftlicher Verhältnisse betrachtet, ist selbst immer bruchstückhaft, schöpferisch und niemals nur Abbild eines Eigentlichen (vgl. Schnell 1995). Diese Schiefe im Mythos des Wohnens, erst recht der äußerst unscharf definierten gelingenden Wohnarbeit, aufzuzeigen, könnte unser Verständnis des Wohnens auf eine Weise erschüttern, dass das Korsett des So-Wohnen-Müssens auch nicht mit neuen schützenden Mythen zugekleistert werden könnte. Ungleiche Wohnverhältnisse in ihren Ungerechtigkeiten und Verzerrungen lägen endlich als Thema auf dem Tisch, und das in Zeiten, wo es nahezu unmöglich geworden ist, einen Ort wirksamen Protestes zu besetzen, weil die Verantwortlichen schon wieder anderswo oder erst gar nicht auszumachen sind. Ein Ende der Schonzeit wäre mir jedenfalls weitaus lieber als ein pflegend-schonendes „Betreuungsverhältnis" à la Martin und Elfriede Heidegger. Darüber brauchen wir nicht den Verstand zu verlieren, ein gerechter Ausgleich genügt. Don't get mad, get even!
Literatur
Arendt, Hannah (1967): Vita Activa oder vom tätigen Leben, München.
Beck-Gernsheim, Elisabeth (1998): Was kommt nach der Familie? Einblicke in neue Lebensformen, München.
Benn, Gottfried (1949): Der Ptolemäer, in: Gesammelte Werke II, 1395-1414.
Benjamin, Walter (1966): Angelus Novus. Über den Begriff der Geschichte These IX, in: Ausgewählte Schriften 2, Frankfurt/Main.
Cameron, Angus (2006): Geographies of Welfare and Exclusion: Social Inclusion and Exception, in: Progress in Human Geography 30, 3, 396 – 404.
Cameron, Angus (2005): Geographies of Welfare and Exclusion: Initial Report, in: Progress in Human Geography 29, 2, 194 – 203.
Conrad, Sebastian/Osterhammel, Jürgen (Hrsg.) (2004): Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871 – 1914, Göttingen.
Curtis, Kimberley (1999): Our Sense of the Real. Aesthetic Experience and Arendtian Politics, Cornell University Press: Ithaca, London.
Dorling, Danny/Shaw, Mary (2002): Geographies of the Agenda: Public Policy, the Discipline and its (Re)'Turns', in: Progress in Human Geography 26,5, 629- 646.
Devetter, Francois-Xavier/Rousseau, Sandrine (2011): Du balai. Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité, Éditions raisons d'agir: Ivry-sur-Seine.
Honneth, Axel (1999): Die zerrissene Welt des Sozialen: sozialphilosophische Aufsätze, Frankfurt/ Main.
Jäger, Michael/Seibert, Thomas (2012): alle zusammen. jede für sich. die demokratie der plätze, Hamburg.
Jessop, Bob (2002): Capitalism, the Regulation Approach, and Critical Realism, in: Brown, A./ Fleetwood, S./Roberts, J. M. (Eds.): Critical Realism and Marxism, 88 – 115.
Klagge, Britta (2005): Armut in westdeutschen Städten: Strukturen und Trends aus stadtteilorientierter Perspektive – eine vergleichende Studie der Städte Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hannover und Stuttgart, Stuttgart.
Kronauer, Martin/Vogel, Berthold (2001): Erfahrung und Bewältigung von sozialer Ausgrenzung in der Großstadt: Was sind Quartierseffekte, was Lageeffekte?, in: SOFI-Mitteilungen 29/221, 45 – 58.
Lefêbvre, Henri (1990): Die Revolution der Städte, Frankfurt/Main.
Lewis, Anthony (2012): The Shame of America. Book Review of „The Persistence of the Color Line: Racial Politics and the Obama Presidency" by Randall Kennedy and „Elizabeth and Hazel: Two Women of Little Rock" by David Margolick, in: New York Review of Books, January 2012, 47 – 48.
Marchart, Oliver (2010): Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben, Frankfurt/Main.
Merrifield, Andy (2011): Magical Marxism. Subversive Politics and the Imagination, PlutoPress: New York.
Mohan, John (2002): Geographies of Welfare and Social Exclusion: Dimensions, Consequences and Methods, in: Progress in Human Geography 26, 1, 66 – 75.
Mohan, John (2000): Geographies of Welfare and Social Exclusion, in: Progress in Human Geography 24, 2, 291 – 300.
Pratt, Geraldine (2004): Working Feminism, Philadelphia.
Sayer, Andrew (2000): Realism and Social Science, London.
Schnell, Martin W. (1995): Phänomenologie des Politischen, München.
Simon, Jonathan (2007): Governing Through Crime, New York.
Soja, Edward D. (2010): Seeking Spatial Justice, Minneapolis, London.
Quelle: geographische revue, 14. Jahrgang, 2012, Heft 1, S. 81-103
zurück zu Rezensionen
zurück zu raumnachrichten.de
