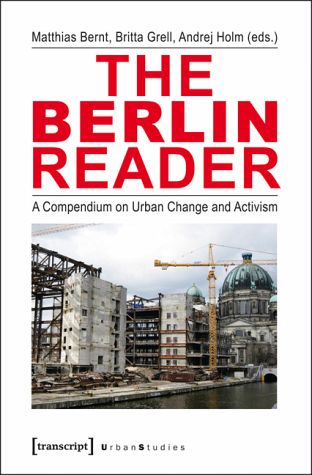Samuel Merrill, Sandra Jasper: Was ist so Berlin? Eine kritische Betrachtung aktueller Linien und Fragestellungen der Stadtforschung zur deutschen Hauptstadt. Konferenzbericht und Buchrezension
Einleitung
Ende 2012 startete das Berliner Stadtmagazin zitty die Werbekampagne „Das ist so Berlin“. Gelegentlich kann man die kleinen rot-weißen Aufkleber der Kampagne, die 2013 überall in der Stadt, auf Mülleimern, U-Bahn-Schildern und Bushaltestellen auftauchten, heute noch finden. Während diese Kampagne auf die vermeintliche Besonderheit Berlins anspielte, hoben im selben Jahr eine Reihe von wissenschaftlichen Veranstaltungen und Publikationen das zunehmend internationale Stadtforschungsprofil von Berlin hervor – beziehungsweise hinterfragten dieses. Sitzungen der Jahreskonferenz der Association of American Geographers (AAG) in Los Angeles (9.-13. April 2013)[1] sowie des Jahrestreffens des Research Committee 21 (RC21) der International Sociological Asscociation in Berlin (29.-31. August 2013) rückten die deutsche Hauptstadt in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Aufmerksamkeit. Zeitgleich machte ein Sammelband mit dem Titel The Berlin Reader: A Compendium on Urban Change and Activism (2013) zum ersten Mal eine Vielzahl wichtiger deutschsprachiger Stadtforschungsaufsätze zu Berlin einer internationalen englischsprachigen Leser_innenschaft zugänglich.
Die nachfolgende Betrachtung gibt einen Überblick über die zwei wissenschaftlichen Veranstaltungen und den Sammelband, wobei sie sich mit den Forschungsthemen, Debatten und kritischen Fragen, die dabei aufgeworfen wurden, beschäftigt. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf eine der zentralen Fragestellungen der Diskussionen, nämlich inwieweit Berlin als exzeptioneller oder paradigmatischer Fall der Stadtentwicklung verstanden werden kann. Eine Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Forschung zu Berlin ist demnach auch mit breiteren Debatten über die Vorzüge und Begrenzungen verschiedener Ansätze der Stadtforschung verbunden. Somit dreht die Rezension die Behauptung der Zeitschrift zitty, Berlin sei außergewöhnlich, um. Dabei stellt sie die hypothetische Frage: Was ist ‚so Berlin’ an der gegenwärtigen Stadtforschung? Des Weiteren diskutiert sie einige der Antworten, die von den genannten Veranstaltungen und der Publikation auf diese Frage gegeben wurden.
Die Betrachtung ist in vier Abschnitte unterteilt. Die ersten beiden fassen die Präsentationen und Diskussionen auf den AAG-Sitzungen und der RC21-Sitzung zusammen, der dritte befasst sich mit dem erwähnten Berlin Reader. Abschließend werden einige der Debatten benannt, die sich quer durch die genannten Foren zogen. Diese Synthese soll den Leser_innen einen präzisen Einblick in einige der aktuellen Themenfelder der Forschung in und zu Berlin verschaffen und gleichzeitig kritische Perspektiven vorstellen, die eine vermeintliche Ausnahmerolle der Stadt infrage stellen. Besondere Aufmerksamkeit liegt hierbei auf der in der Berlin-Forschung verwendeten Terminologie, auf der Rolle und Position der Forscher_innen in Berlin und auf Lücken in aktuellen Forschungsvorhaben.
1. Die ‚Moving-to-Berlin‘-Sitzungen, AAG
Sechs AAG-Sitzungen zum Oberthema ‚Moving to Berlin – a growing laboratory of urban thought and research?’ hatten das Ziel, die Faszination, die die Stadt seit einiger Zeit auch auf Wissenschafter_innen ausübt, zu beleuchten. Außerdem sollten Einsichten in die wissenschaftlichen Diskurse gewonnen werden, welche die Forschung zu Berlin gegenwärtig prägen. Um eine kontroverse Debatte zu provozieren, wurde die aktuelle Berlin-Forschung im Kontext von Konzepten wie dem der paradigmatic cities diskutiert und mit der Los Angeles School verglichen. In vier Sitzungen wurden die Themenfelder Erinnerungsproduktion, kulturelle Räume und Praktiken, Wohnungsbau und Stadtteile im Wandel sowie das ‚neue Berlin‘ behandelt. Diese Sitzungen wurden durch ein Eröffnungs- und ein Abschlussplenum gerahmt.
Edward Soja, Laura Pulido, Claire Colomb, Allan Cochrane und Matthew Gandy waren eingeladen, im Eröffnungsplenum die Vor- und Nachteile zu diskutieren, die der Gebrauch von Konzepten und Bezeichnungen wie paradigmatic city oder school im Kontext von Berlin hat. Sie waren aufgefordert, Vergleiche zwischen der Stadtforschung zu Berlin und Los Angeles zu ziehen und zu hinterfragen, inwieweit die oben genannten Ansätze die Theoretisierung von Städten und globalen städtischen Netzwerken erweitern oder begrenzen. Die Podiumsgäste kritisierten, dass der Fokus der Los Angeles School auf spezifische städtische Phänomene und Formen von Aktivismus wichtige Forschungsfelder vernachlässigt habe, die mit der Geschichte der Stadt eng verknüpft seien. Pulido betonte unter anderem den Mangel einer historisch fundierten Perspektive und das daraus resultierende Versäumnis der Los Angeles School, sich kritisch mit der Geschichte von Kolonialismus und Genozid auseinanderzusetzen. Während Cochrane Parallelen zog zwischen den Kräften, die die Stadtforschung in Los Angeles ab den 1970er Jahren und in Berlin nach 1989 antrieben, lehnte Colomb den Vorschlag ab, Konzepte aus dem einen auf den anderen Kontext zu übertragen. Sie kritisierte, dass es eine Schwäche der diskutierten Ansätze sei, Berlin entweder als Sonderfall oder als Barometer für allgemeingültige Entwicklungen zu interpretieren, da sie sich vorrangig auf Theorien städtischer Entwicklung beziehen, die in einem spezifisch US-amerikanischen Kontext zu verorten seien.
Die Vorstellung von ‚paradigmatischen Städten‘ und ‚Stadtforschungsschulen‘ wurde allgemein abgelehnt zugunsten einer „eher vergleichenden, empirischen und politisierten Forschung“, wie Soja formulierte. Jedoch betonten die Podiumsgäste auch die Bedeutung historischer Ansätze, die spezifische zeitliche Abschnitte beleuchten könnten, in denen Städte als Katalysatoren kritischer intellektueller Auseinandersetzungen wirkten. Entsprechend veranschaulichte Gandy die wichtige Rolle Berlins als experimentelle Stadt und Zentrum der internationalen Moderne während der Weimarer Zeit. Als Ergebnis dieser Sitzung ist festzuhalten, dass die Los Angeles School ihre eigene intellektuelle Geschichte, ihren Ort und ihre Zeit hat(te). Daher können ihre Grundannahmen nicht problemlos auf andere Kontexte, auch nicht auf Berlin, übertragen werden.
Die darauffolgenden Sitzungen zu Erinnerungsproduktion, kulturellen Räumen und Praktiken, Wohnungsbau und Stadtteilen im Wandel und dem ‚neuen Berlin‘ kombinierten historische Beiträge mit Vorträgen zu gegenwärtigen Prozessen, um die Verbindungen unterschiedlicher Forschungslinien, die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt worden sind, aufzuzeigen. Präsentationen zu basisdemokratischer Erinnerungsproduktion (Samuel Merrill), ‚offizieller‘ Memoralisierung (Jeffrey Wallen, Julia Binder) und künstlerischen Praktiken (Beatrice Jarvis) legten nahe, dass Berlins Anspruch auf einen paradigmatischen Stellenwert wohl am ehesten im Feld der social memory studies (sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung) erhoben werden kann. Sie verdeutlichten zudem, dass Studien zu kollektiver Erinnerung nur selten explizit Bezug nehmen auf Themenfelder und Ansätze der kritischen Stadtforschung oder soziale Bewegungen, und stellten damit mögliche zukünftige Forschungsfelder heraus. Einige Beiträge diskutierten, wie sich Prozesse der Privatisierung und Spekulation mit Grund und Boden und die hieraus resultierenden Konflikte auf kulturelle Räume und Praktiken in Berlin auswirkten. Diese Konflikte schlugen sich in stadtplanerischen und architektonischen Projekten der frühen Nachkriegsjahre nieder (Sandra Jasper) und haben bis heute für transitorische kulturele Räume und Praktiken Relevanz behalten, da diese zunehmend dem Druck von Kommodifizierung und Regulierung ausgesetzt sind (Karen Till, Christian Haid und Luise Rellensmann/ John Schofield). In der Sitzung zum Thema Wohnungsbau wurde eine Studie zur Geschichte der Berliner Hausbesetzungen (Alex Vasudevan) zusammen diskutiert mit einem aktuellen Fall, dem im Februar 2011 von der Polizei geräumten linken Hausprojekt Liebig14 in Berlin-Friedrichshain (Lucrezia Lennert). Ein weiterer Beitrag befasste sich mit der technokratischen Wohnungspolitik der zweiten Hälfte der 1940er Jahre (Clara Oberle), gefolgt von Ausführungen zur aktuellen Berliner Wohnungspolitik und den damit verbundenen Deregulierungsprozessen, die dafür sorgen, dass bestimmte Teile der Bevölkerung in ‚periphere Bezirke‘ abgedrängt werden (Daniel Förste). Beiträge der Sitzung zum ‚neuen Berlin‘ konzentrierten sich auf die 1990er und 2000er Jahre. Sie analysierten Prozesse einer beschleunigten Stadtentwicklung und diskutierten die Folgen einer forcierten Anpassung der Stadt an ein neoliberalistisches Entwicklungsmodell (Claire Colomb/ Johannes Novy, Nicole Huber). Die Beiträge beschäftigten sich mit Metaphern, blinden Flecken der Forschung und Zeitabschnitten, auf die sich die Rede von einem ‚neuen Berlin‘ bezieht. Dabei wurden Probleme offengelegt, die mit dem Versuch verbunden sind, eine Stadt mit einem einzigen Adjektiv zu kategorisieren (Deike Peters, Matthew Gandy).
Das Abschlussplenum bot den Referent_innen der einzelnen Sitzungen (Gandy, Huber, Peters und Vasudevan) und Volker Eick, der die siebte AAG-Sitzung zu Berlin mit dem Titel ‚Policing its Crisis: Berlin between Powerhouse & Poverty‘ vertrat, die Möglichkeit, gewinnbringende Erkenntnisse aus vorangegangenen Diskussionen aufzugreifen und zu vertiefen. In der Debatte verwiesen einige Teilnehmer_innen auf das breite Spektrum der theoretischen und disziplinären Perspektiven und Methoden, die angewendet werden, um die Besonderheiten Berlins herauszustellen, und monierten, dass ein gemeinsamer analytischer Rahmen fehle. So kritisierte Andrej Holm die AAG-Sitzungen für ihr Versäumnis, ein übergreifendes kritisches Erklärungsmodell anzubieten, das Prozesse städtischer Entwicklung erfassen könnte. Holm und Vasudevan riefen dazu auf, einen größeren Schwerpunkt auf Ansätze der politischen Ökonomie zu legen.[2] Zugleich schien ein gemeinsamer Bezugsrahmen der meisten der interdisziplinär verorteten Referent_innen (Geographie, Geschichte, Kunst, Planung, Archäologie und Stadtforschung) zu sein, das besondere Potenzial historischer Perspektiven zu nutzen, um unser Verständnis von Berlin zu erweitern. Entsprechend hatten die Sitzungen versucht, die Anwendung eines einzelnen Erklärungsmodells a priori zu vermeiden. Stattdessen sollte ein breiter interdisziplinärer Austausch über die Stadt neue Einsichten generieren, die nicht von eng gefassten disziplinären und chronologischen Erkenntnisinteressen begrenzt werden.
2. Questioning Berlin, RC21
Die RC21-Konferenz 2013 ‚Resourceful Cities‘, ausgerichtet an der Berliner Humboldt-Universität, bestätigte das neu erwachte wissenschaftliche Interesse an Berlin. Die Tatsache, dass die RC21-Konferenz in Berlin stattfand, wurde als einer der Hauptgründe für die hohe Zahl der Teilnehmenden angeführt. Anlässlich der Tagung veröffentlichte das International Journal of Urban and Regional Research (IJURR) eine frei zugängliche Sonderausgabe online, in der Ute Lehrer Berlin als „capital of contradictions“ einführte und 18 zuvor in IJURR publizierte Artikel zur Stadt vorstellte. Die Widersprüche Berlins wurden während der Konferenz besonders deutlich dank der von Andrej Holm und Claire Colomb organisierten Sitzung ‚Questioning Berlin‘, in der auch der Sammelband The Berlin Reader: A Compendium on Urban Change and Activism, herausgegeben von Matthias Bernt, Britta Grell und Andrej Holm, vorgestellt wurde.
Die Sitzung ‚Questioning Berlin‘ brachte sowohl Nachwuchs- als auch etablierte Wissenschaftler_innen zusammen, die aktuell zu Berlin arbeiten oder in der Vergangenheit zu Berlin geforscht haben (Claire Colomb [stellvertretend für Johannes Novy], Matthias Bernt, Margit Mayer und Sabina Uffer). Ziel der Sitzung war es, zu klären, ob die Entwicklungen in Berlin im Licht globaler Perspektiven interpretiert werden sollen oder ob Berlin als eine Ausnahmeerscheinung zu verstehen ist, welche die Anwendung von Fragestellungen aus anderen städtischen Kontexten sinnlos erscheinen lässt. So war es zumindest im Konferenzprogramm nachzulesen. Mit dieser Fragestellung, ob städtische Veränderungsprozesse in Berlin die lokalen Implikationen globaler Prozesse verdeutlichen, schloss die Diskussion in gewisser Weise an den Versuch der AAG-Sitzungen an, Berlins Sonderstatus zu hinterfragen. Trotz vieler Überschneidungen bei den Teilnehmer_innen und den empirischen und theoretischen Beiträgen wurde darauf leider nicht explizit inhaltlich eingegangen. Damit blieb die Hoffnung auf einen Dialog über Konferenzen, Gruppen und Kontinente hinweg weitestgehend unerfüllt.
Die Sitzung ‚Questioning Berlin‘ zielte darauf ab, die Unterschiede zwischen lokalen und internationalen Interpretationen der Stadt zu thematisieren. Die Organisator_innen positionierten sich kritisch – fast schon entschuldigend – gegenüber den Schwächen, die sie in einem Großteil der internationalen Forschung zu Berlin, insbesondere in Studien aus dem anglophonen Raum, auszumachen meinen. Die Sitzung wie auch der Berlin Reader beton(t)en das Versäumnis internationaler Forschung, die Einsichten der deutschsprachigen Berlin-Forschung zu nutzen oder zumindest davon Notiz zu nehmen. Zugleich würde versucht, Theorien und Konzepte a priori aus anderen Kontexten auf die Stadt zu übertragen. Ähnliche Bedenken waren auch während der AAG-Sitzungen in der Diskussion über die Position, Aufgabe und den Einfluss von Forscher_inen geäußert worden. Man kann dies auch als die Wiederbelebung einer einige Jahre zurückliegenden Debatte zwischen Alan Latham und Allan Cochrane verstehen, die in der Zeitschrift European Urban and Regional Studies veröffentlicht wurde (Cochrane 2006, Latham 2006a; 2006b). 2013 kommentierte Cochrane diese Bedenken als Korreferent der RC21-Sitzung, indem er auf tendenzielle Unterschiede zwischen anglophonen und deutschsprachigen Forscher_innen hinwies. Er hob aber vor allem die Spannung zwischen Ansätzen hervor, die Berlin als ein Fallbeispiel (Berlin as a case) konzeptualisieren, und solchen, die Berlin als Ort (Berlin as a place) begreifen. Ersterer Ansatz werde vorrangig von anglophonen Wissenschaftler_innen vertreten, die, wie er selbst, in den frühen 1990er Jahren von der Stadt angezogen worden seien. Sie konzipierten Berlin metaphorisch als „Spielwiese“, als „weiße Leinwand“ und vielleicht am häufigsten als „Labor“, in dem Alternativen zu globalen städtischen Prozessen bestätigt, getestet oder entdeckt werden konnten. Die Vorträge von Colomb, Bernt, Mayer und Uffer bei der RC21 haben Berlin letztlich eher als einen Ort (place) betrachtet, so Cochrane – durch ihre Forschungsvielfalt, die lokale Spezifika analysiere, ohne Berlins Einzigartigkeit zu zelebrieren oder die Verbindungen zu internationalen Theorien und Prozessen und deren Implikationen aus dem Blick zu verlieren.
3. Der Berlin Reader
Dem Tenor der RC21-Sitzung entsprechend, gehen auch die Herausgeber_innen des Berlin Readers davon aus, dass viele internationale Autor_innen, die sich mit der Stadt befassen, zu wenig den spezifischen politischen, historischen und ökonomischen Kontext Berlins berücksichtigten. Sie führen dies vor allem auf Sprachbarrieren zurück, die diese davon abhalten würden, deutschsprachige Literatur und deutsche Quellen zu rezipieren. Daher ist das explizit genannte Ziel des Readers, einen Teil der deutschsprachigen Berlin-Forschung durch die Übersetzung von ausgewählten Texten ins Englische zugänglich zu machen. Diese Absicht ist ehrenwert. Zugleich erscheint es uns irritierend, dass in der Einleitung kategorisch eine Reihe von Faktoren genannt wird, die „notwendig sind, um Berlin zu verstehen“. Anschließend an eine kurze Erläuterung dieser Faktoren (nämlich die Auswirkungen der Teilung der Stadt während des Kalten Krieges, die anhaltende kommunale Finanzkrise, die bereits früh zu einer Austeritätspolitik führte, und eine historisch bedingte besondere Planungskultur) präsentiert der Band 16 Artikel, die grob chronologisch unter den folgenden Kapitelüberschriften angeordnet sind: Berlin’s Megalomania, Berlin In-Between, Berlin On Sale und Berlin Contested. Die Sammlung vereint 14 bereits veröffentlichte Arbeiten (davon zehn ursprünglich in deutscher Sprache) sowie zwei Erstveröffentlichungen. Sozialwissenschaftliche Artikel wechseln sich mit journalistischen Aufsätzen ab, wobei die frühesten Texte aus den unmittelbaren Nachwendejahren stammen.
Jeden einzelnen Beitrag zu kommentieren, liegt außerhalb des Rahmens dieser allgemein gehaltenen Rezension. Die Aufsätze haben ihre Stichhaltigkeit größtenteils schon bewiesen und sind in etablierten wissenschaftlichen Foren diskutiert worden. Zusammen decken sie die zentralen Forschungsthemen der Nachwendezeit ab, unter anderem städtische Segregation, Gentrifizierung, Privatisierung und die daraus resultierenden Konflikte und sozialen Kämpfe. Einige Essays können inzwischen als historische Quellen betrachtet werden, die die rapiden städtischen Veränderungsprozesse während der 1990er Jahre dokumentieren. Andere Beiträge zeigen zukünftige Forschungsfelder auf und verweisen auf die Notwendigkeit, sowohl sich verändernde regulative und rechtliche Rahmenbedingungen wie auch die von Holm benannten „lokal spezifischen Entwicklungslinien“ Berlins einzubeziehen.
Alle Beiträge sind, wie zu erwarten, von sehr hoher wissenschaftlicher Qualität. Dieser Eindruck wird leider vereinzelt durch Übersetzungs-, Grammatik- und editorische Fehler getrübt, die sicherlich damit zusammenhängen, dass das Buch unter hohem Zeitdruck entstanden ist, und mit der Entscheidung, verschiedene Übersetzer_innen zu beauftragen. Dies stört zwar punktuell, dennoch ist der Sammelband aus inhaltlichen Gründen zu empfehlen. Es gelingt dem Berlin Reader, die historischen, politischen und ökonomischen Kontexte der Berliner Stadtentwicklung aufzuzeigen, die die Herausgeber_innen in einem Großteil der internationalen Berlin-Forschung vermissen. Somit könnte sich dieser Sammelband als ein nützliches Hilfsmittel für internationale Wissenschaftler_innen erweisen, die in und zu Berlin forschen.
4. Jenseits eines Berliner Sonderstatus
Die AAG- und RC21-Sitzungen ebenso wie der Berlin Reader haben die Annahme von einem ‚Sonderfall Berlin‘ (Berlin’s exceptionalism) infrage gestellt. Sie bestätigten jeweils auf unterschiedliche Art und Weise, dass die Anwendung von international gebräuchlichen stadttheoretischen Konzeptionen bei gleichzeitiger Abwesenheit eines gemeinsamen Konsenses über theoretische und methodologische Grundlagen sowie persönliche Motivationsgründe von Ambivalenzen geprägt ist, die letztendlich Vorstellungen von einer Berliner Stadtforschungsschule oder einem paradigmatischen Berliner Modell unmöglich machen. Mit der Zurückweisung solcher Vorstellungen hat sich allerdings nicht die Frage erübrigt, warum die Faszination, die Berlin als Forschungsfeld auf die wissenschaftliche Community ausübt, fortbesteht. Matthew Gandy führt die Besonderheit Berlins auf eine „ausgeprägte metropolitane Sensibilität“ (distinct metropolitan sensibility) zurück – ein Argument, das sich mit Nik Theodores Hinweis auf das Vermächtnis kritischer Stadtforschung aus der Weimarer Zeit verknüpfen lässt. Für Theodore gibt es einen auffälligen Kontrast zwischen dieser Tradition und dem gegenwärtigen Mangel an kritischer Theorie in der deutschsprachigen Forschung.
Superlative und Metaphern
Eine Vielfalt von Superlativen und Metaphern ist bisher in Umlauf gebracht worden, um Berlin zu beschreiben und zu verstehen. Die Stadt wurde mit Adjektiven wie neu, zunehmend globalisiert, auf dem Weg hin zu einer Normalisierung, experimentell, geteilt, alltäglich und widersprüchlich belegt, und Forscher_innen haben sich ihr als Fallbeispiel, Ort, Labor, weiße Leinwand, Spielwiese oder Studio angenähert. Jedoch blieb bisher unklar, wo die Stadt auf einer Skala zwischen ‚typisch‘ und ‚Sonderfall‘ einzuordnen ist. Sind all diese Begriffe hilfreich, um Berlin zu untersuchen? Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen stereotypischen, archetypischen oder prototypischen Behauptungen (Brenner 2003)? Sollten wir den Hinweis von Bernt et al. ernst nehmen und uns damit abfinden, dass es einen einzigen gültigen konzeptionellen Rahmen zur Erforschung Berlins, auf den sich alle einigen könnten, nicht länger gibt (2013: 12), und stattdessen die wissenschaftliche, methodische und rhetorische Vielfalt begrüßen, die die Stadt selbst hervorbringt?
Wenn wir diese Frage mit ja beantworten, dann wäre es aber notwendig, nicht nur Superlative in die Welt zu setzen und rhetorische Gesten zu pflegen, sondern auch kritisch nach deren analytischem Gehalt zu fragen (Beauregard 2003), sodass sich erschließt, mit welcher Motivation und welchen Konsequenzen die genannten Metaphern jeweils benutzt werden. Die Stadt als Labor ist eine besonders häufig verwendete Metapher für Berlin. Während sie für bestimmte historische Zeitabschnitte sicherlich zutraf und ihre Relevanz hatte – nicht zuletzt für West-Berlin während der Teilung der Stadt –, stellt sich die Frage: Worauf bezieht sich eine solche Metapher heute? Ist ein Labor ein Konzept, eine Methode oder ein Ort, und erlaubt es der Begriff, normative Fragen zu thematisieren? Eick und Vasudevan äußerten während der AAG-Sitzungen Skepsis gegenüber dem analytischen und kritischen Potenzial dieses Begriffs. Sie wiesen auf die Machtbeziehungen hin, die dem Labor zugrunde liegen. Wenn die Stadt ein Labor ist, welche Experimente finden dort statt, und, wie Eick treffend fragte: „Wer sind die Wissenschaftler_innen, und wer die Ratten?“
Eine kontinuierliche kritische Reflexion hinsichtlich der Verwendung von Begriffen und dem Einsatz von Sprache ist in einem interdisziplinären Forschungsfeld wie dem der Stadtforschung unerlässlich. Gandy betonte auf der Konferenz in Los Angeles, dass die Einführung einer vereinfachten wissenschaftlichen Terminologie nicht die Lösung dafür sei, die begrifflichen Hürden, mit der sich interdisziplinäre Forschung konfrontiert sieht, zu überbrücken. Nur eine rigorose Auseinandersetzung mit anderen Wissensfeldern ermögliche aber den Austausch quer zu disziplinären Grenzen. Vielleicht trifft es zu, wie dort auch vermutet wurde, dass solche Abgrenzungen im deutschen Wissenschaftssystem besonders ausgeprägt sind, da dieses zu einer Betonung disziplinärer und institutioneller Differenzen neigt, und dies zulasten von Kooperation zwischen spezifischen intellektuellen Traditionen und Themenstellungen und über diese hinaus.[3]
Die Rolle und Position von Berlin-Forscher_innen
In den aktuellen Auseinandersetzungen in der Berlin-Forschung scheint es bisweilen zugespitzt um die Frage zu gehen, wer das Recht hat, eine Stadt zu erforschen, beziehungsweise darum, wer darüber zu entscheiden hat. Hier besteht die Gefahr, dass Differenzen hinsichtlich des theoretischen Zugangs und der Methoden durcheinander geraten mit Vorbehalten gegenüber der Herkunft der Forscher_innen. Dies kann zu grob vereinfachenden Beurteilungen führen. So könnten die Ausführungen von Cochrane auch missverstanden werden, und zwar so, dass internationale Forscher_innen, die Berlin als Fallbeispiel (case) untersuchen, deren spezifischen Kontext als Ort (place) verfehlen, da dieser nur durch lokale verortete Wissenschaftler_innen erfasst werden kann. Letztendlich sind, wie Holm auf der RC21-Sitzung ‚Questioning Berlin‘ anmahnte, beide Ansätze und Gruppen von Forscher_innen notwendig, um unser Verständnis der Stadt voranzubringen.
Dennoch bleibt, auf die potenziellen Risiken hinzuweisen, die damit verbunden sind, wenn fortlaufend spezifische Forschungsansätze (mit all ihren Vorzügen und Mängeln) bestimmten Gruppen von Wissenschaftler_innen zugewiesen werden, im besten Fall entlang von Sprachgrenzen und im schlimmsten Fall entlang von Nationalitäten unterteilt. Leider ist die auf englische Publikationen fokussierte Wissenschaftskultur dazu geeignet, diese Spannungen noch weiter zu verstärken, da sie Forschung über sprachliche Grenzen hinaus einseitig einengt.[4]
Wenn wir aber alle das Recht haben, Berlin zu erforschen – wo liegt dann unsere Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Bewohner_innen? Inwieweit sind wir mitverantwortlich für die Phänomene, die wir in Berlin erforschen? Und wie werden diese Fragen durch ein Streben nach sozialer und räumlicher Gerechtigkeit (social and spatial justice) weiter verkompliziert? Eine Vielzahl von Vorträgen in den erwähnten Konferenzsitzungen haben die besondere Rolle von Wissenschaftler_innen angedeutet, sei es als Aktivist_innen, Choreograph_innen oder Tourist_innen, aber zu selten stand diese Frage im Fokus der Diskussion. Kritische Reflexionen zum Standpunkt des Wissenschaftlers/der Wissenschaftlerin sucht man im Berlin Reader vergeblich, genauso wie ein Bekenntnis dazu, dass diese Publikation selbst eine akademische Variante des city boosterism (eines aktiven Bewerbens der Stadt) darstellen könnte, den viele Autor_innen kritisieren. Wie die RC21-Konferenz 2013 in Berlin zeigte, werden offenbar viele Forscher_innen aufgrund der aktuellen kulturellen Bedeutung Berlins und der weitverbreiteten Auffassung, Berlin sei „the place to be“[5], in die Stadt gelockt, aber natürlich auch von deren relativ niedrigen Lebenshaltungskosten und deren Offenheit gegenüber verschiedenen Lebensweisen. Wie steht es mit der Zunahme von US-amerikanischen und britischen Studienreisen nach Berlin und den Geografien der Wissensproduktion, die sie importieren? Welche Rolle spielen diese Akademiker_innen und Studierenden für städtische Veränderungsprozesse wie Touristifizierung und Gentrifizierung, zu deren Erforschung sie oftmals nach Berlin gekommen sind?
Blinde Flecken der Berlin-Forschung
Keines der bisher genannten Foren, ob Konferenzen oder Publikationen, kann die Berlin-Forschung in ihrer ganzen Vielfalt abdecken. Trotzdem können sie Aufschluss über die vielschichtigen konzeptionellen Schwächen und Wissenslücken geben, die die Berlin-Forschung weiterhin kennzeichnen. So hat Deike Peters während der AAG-Sitzungen darauf hingewiesen, dass es mehr Forschung auf der Ebene von Nachbarschaften gibt als auf der regionalen oder metropolitanen Ebene. Peters hob spezifische Orte der Stadt hervor, wie zum Beispiel einige groß angelegte städtische Sanierungs- und Infrastrukturprojekte, die bisher wenig wissenschaftlich beleuchtet würden. Dies könnte damit zusammenhängen, dass hiermit nicht notwendigerweise größere Verdrängungsprozesse verbunden sein müssen oder dass die betroffenen Bewohner_innen politisch weniger sichtbar sind. Diese Einschätzung verweist darauf, welche zentrale Rolle Prozesse der Neoliberalisierung wie Gentrifizierung und Privatisierung gegenwärtig in Forschungsvorhaben, die sich mit Berlin beschäftigen, einnehmen. Hier liegt weiterhin ein Schwerpunkt der Forschung, obwohl seit Längerem diskutiert wird, inwieweit ein allgemeines, neoliberalistisches Modell auf Berlin überhaupt übertragbar ist. Vielleicht gibt es kein einzelnes kritisches Rahmenkonzept, das Berlin (und im Prinzip jede andere Stadt) in all ihren Widersprüchen und ihrer Komplexität gerecht wird. Dementsprechend existiert wohl auch kein Begriff und keine Metapher, mit der man die Stadt mit all ihren Facetten erfassen kann, worauf schon die Herausgeber_innen des Berlin Readers hingewiesen haben.
Daher stellt sich die Frage: Welche Konzepte und Perspektiven könnten in der Berlin-Forschung nützlich sein? Was sind zum Beispiel die Implikationen einer Perspektive, die Berlin deutlicher als postsozialistische Stadt konzeptualisiert?[6] Alex Vasudevan hat in diesem Zusammenhang die Tendenz festgestellt, bestimmte historische Momente in der Geschichte Berlins zulasten von anderen zu „fetischisieren“. Dies ist eine Schwäche aktueller Forschungsvorhaben, die sich auch im Inhalt des Berlin Readers widerspiegelt. Er beinhaltet keine Aufsätze, die vor 1989 verfasst wurden; die aufgenommenen Beiträge stammen alle aus der Nachwendezeit. Die anhaltenden Auswirkungen der Teilung der Stadt während des Kalten Krieges werden zwar erwähnt, wir erfahren jedoch wenig über den Prozess der Vereinigung oder die vorangegangenen historischen Phasen und die Implikationen, die diese inhaltlich und strukturell für die gegenwärtige wissenschaftliche Forschung zu Berlin und die damit verbundenen Auseinandersetzungen über städtische Entwicklungsprozesse haben. Wie eine Vielzahl der Vorträge auf der AAG betonten, haben einige Aspekte des sogenannten ‚neuen Berlins‘ tatsächlich eine längere Vorgeschichte, die dem Jahr 1990 vorangeht.
Mit der Darstellung dieser Themen und den sie begleitenden Problemstellungen und aufgeworfenen Fragen hoffen wir, einen kleinen Beitrag zur Debatte um die zukünftige Forschung zur „Hauptstadt der Widersprüche“ (Lehrer 2013) geleistet zu haben. Aber wichtiger noch: Wir hoffen, dass diese Betrachtung die Notwendigkeit eines fortlaufenden Austauschs darüber aufzeigt, was genau Stadtforschung in Berlin ausmacht, nicht ausmacht und ausmachen sollte. Das Ausmaß der Widersprüche und Eigenheiten von Berlin kann also nur dann erfasst werden, wenn Berlins Stadtforschung fortlaufend so kritisch beleuchtet wird, dass Fragen der methodischen und rhetorischen Vielfalt, der Rolle und Position von Forscher_innen und der blinden Flecken in Forschungsvorhaben Beachtung finden.
Anmerkungen
[1] Die Autor_innen dieser Betrachtung haben die Berlin-Sitzungen der AAG-Konferenz zusammen mit Julia Binder, Karen Till und Claire Colomb organisiert.
[2] Weitere zentrale Themen, die im AAG-Abschlussplenum diskutiert wurden, werden im letzten Teil dieser Rezension aufgegriffen.
[3] Im Berliner Wissenschaftsbetrieb gibt es allerdings derzeit mindestens zwei institutionelle Beispiele im Bereich interdisziplinär ausgerichteter Stadtforschung, die diesen Befund nicht bestätigen, und zwar das Center for Metropolitan Studies an der Technischen Universität und das Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung an der Humboldt-Universität.
[4] Daher sind zwei- oder mehrsprachige wissenschaftliche Fachzeitschriften so wichtig. Wir danken in diesem Zusammenhang der Redaktion von sub\urban nochmals ausdrücklich für ihre Zustimmung, diese Rezension in deutscher und englischer Sprache zu veröffentlichen.
[5] Dies wurde kürzlich zum wiederholten Male von Klaus Wowereit in seiner Rücktrittserklärung vom Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin betont (vgl. Smale 2014).
[6] Wenige der oben genannten Beiträge bezogen sich explizit auf Berlins sozialistische Vergangenheit. Im Fall der AAG-Sitzungen sind keine Beiträge zu Berlins sozialistischen oder postsozialistischen Geografien eingereicht worden.
Autor_innen
Samuel Merrill
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Sandra Jasper
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Literatur
Beauregard, Robert A. (2003): City of Superlatives. In: City & Community 2/3, 183-199.
Bernt, Matthias / Grell, Britta / Holm, Andrej (Hg.) (2013): The Berlin Reader: A Compendium on Urban Change and Activism. Bielefeld: Transcript Verlag.
Brenner, Neil (2003): Stereotypes, Archetypes, and Prototypes: Three Uses of Superlatives in Contemporary Urban Studies. In: City & Community 2/3, 205-216.
Cochrane, Allan (2006): Euro-commentary: (Anglo)phoning Home from Berlin: A Response to Alan Latham. In: European Urban and Regional Studies 13, 371-376.
Latham, Alan (2006a): Euro-commentary: Anglophone Urban Studies and the European City: Some Comments on Interpreting Berlin. In: European Urban and Regional Studies 13, 88-92.
Latham, Alan (2006b): Euro-commentary: Berlin and Everywhere Else: A Reply to Allan Cochrane. In: European Urban and Regional Studies 13, 377-379.
Lehrer, Ute (2013): Berlin: Capital of Contradictions. www.ijurr.org/view/IJURRBerlinVI.html (letzter Zugriff am 5.1.2014).
Smale, Alison (2014): Mayor Klaus Wowereit of Berlin Says He Will Step Down. In: The New York Times, 26 August 2014. www.nytimes.com/2014/08/27/world/europe/mayor-klaus-wowereit-of-berlin-says-he-will-step-down.html?_r=0 (letzter Zugriff am 27.8.2014).
Quelle: s u b \ u r b a n, 2014, Band 2, Heft 2, S. 143-154
zurück zu Rezensionen
zurück zu raumnachrichten.de